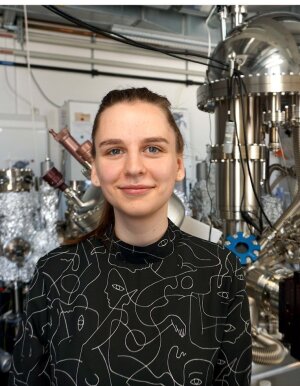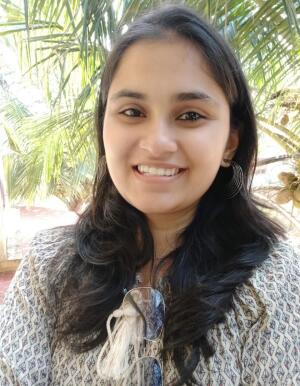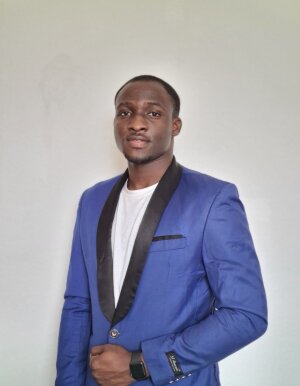Im Juli wurden 67 Studierende in das Programm aufgenommen. Nach zwei digitalen Eröffnungsveranstaltungen (2020 und 2021) konnten wir die neuen Honours-Studierenden und ihre Betreuer:innen in diesem Jahr persönlich willkommen heißen.
-

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena) -

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena) -

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena) -

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena) -

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena) -

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena) -

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena) -

Foto: Christoph Worsch (Universität Jena)
-
Alan Avdagic
Studiengang: Indogermanistik (B.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Martin Kümmel
Asterix apud Thuringios
Auf den Spuren keltischer Vergangenheit in Thüringen
Die Region zwischen Werra und Saale, im Herzen der Provinz Germania Magna, befand sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrtausends vor der Zeitenwende in der keltisch-germanischen Kontaktregion. Schon die antiken Griechen und Römer waren sehr daran interessiert, was sich in den Wäldern der Germania Magna verbarg. Mein Forschungsprojekt soll nun dazu beitragen ein wenig mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Hierbei handelt es sich um eine Untersuchung der Orts- und Gewässernamen Thüringens auf keltische Namenselemente.Thüringen ist dabei von besonderem Interesse, da es als Übergangsgebiet zwischen Kelten und Germanen fungierte. Ziel des Projekts ist es, archäologische Funde und Ortsnamen zusammenzubringen und im besten Falle sogar eine Karte mit der keltischen Ausbreitung in Thüringen erstellen zu können.Kontakt:
alan.avdagic@uni-jena.de -
Lukas Bartl
Studiengang: Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts (M.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Gisela Mettele
Fit für die Einheit?
Sport ist gut für die Gesundheit. Einer solchen Aussage würde heute wohl kaum noch jemand widersprechen. Doch so selbstverständlich eine solche Feststellung wirken mag, so historisch jung ist das weitverbreitete Sporttreiben um des eigenen Körpers willen, welches in den 1970ern an Fahrt aufnahm und spätestens in den 1980er Jahren auch den letzten Couch Potato in die Laufschuhe trieb (oder zumindest für ein schlechtes Gewissen sorgte). Im kollektiven Gedächtnis ist dieses massensportliche Erwachen eng verschränkt mit der Trimm-Dich-Bewegung der 70er und den neonfarbenen Leggings aus dem Aerobic-Kurs in den 80ern. Hierbei handelt es sich aber zuvorderst um Phänomene der westlichen Welt. Wie jedoch entwickelte sich der Fitness-Trend in der ehemaligen DDR, wo Risikofaktoren und Jogging ebenfalls an Popularität gewannen? Dieser Frage will ich in meinem Projekt nachgehen, indem ich die populäre Zeitschrift „Deine Gesundheit“ der Jahre 1980 – 1993 einer näheren Analyse unterziehe. -
Anna Katharina Brauckmann
Anna Katharina Brauckmann
Foto: privatStudiengang: Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts (M.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller
„Versöhnung oder offene Wunden? Eine Analyse der Konzeption, Umsetzung und Bedeutung des Dokumentationszentrums Salamanca (Centro Documental de la memoria histórica)“ (Arbeitstitel)
Bei meinem geplanten Forschungsprojekt handelt es sich um eine Arbeit zum Thema Erinnerung und Umgang mit Vergangenheit in Spanien. Dort gibt es einige Leerstellen in der Auseinandersetzung mit dem Bürgerkrieg (1936-1939), der Diktatur (1939-1975) und der darauffolgenden Transitionszeit. Dies beinhaltet auch das Fehlen einer gesamtgesellschaftlichen, identitätsstiftenden Gedenkstätte. Allerdings befindet sich in Salamanca ein Dokumentationszentrum mit einer Dauerausstellung zum Bürgerkrieg. Im Rahmen des Forschungsprojektes möchte ich die Ausstellungskonzeption analysieren und die Bedeutung dieses Ortes für die gesamtspanische Gesellschaft in den Blick nehmen.
Dazu erfolgt die Analyse im Dreischritt mit drei verschiedenen Quellenarten. Im ersten Schritt werden mit Hilfe von Regierungsdokumenten und Gesetzestexten die staatlichen Intentionen zur Gestaltung dieses Ortes beleuchtet, im nächsten Schritt wird eine Untersuchung der realisierten Ausstellung erfolgen und abschließend wird durch Heranziehen von (über-)regionaler Berichterstattung die Rezeption und Erfüllung der staatlichen Ansprüche beurteilt. So soll die Frage geklärt werden, inwieweit mit diesem Dokumentationszentrum versucht wird, eine national gültige „Meistererzählung“ zu etablieren. -
Philipp Brügge
Studiengang: Archäologie der Ur- und Frühgeschichte (B.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Peter Ettel
Das eisenzeitliche Gräberfeld von Mühlen-Eichsen (MV)
-
Tila de Almeida Mendonça
Studiengang: Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts (M.A.)
Betreuung durch PD Dr. Jochen Böhler
Lehre und Forschung gehen in den Untergrund.
Illegales Bildungswesen im Warschauer Ghetto, 1939-1942.Der deutsche Überfall auf Polen war von Beginn an durch die Verfolgung der dortigen Bildungsschicht gekennzeichnet. Die gesamte als jüdisch definierte Bevölkerung Warschaus erfuhr hinsichtlich der Bildung die umfangreichsten Einschränkungen. Trotzdem reichte innerhalb des Ghettos das illegale Lernangebot vom Kindergarten bis zur Berufsschule und Universität. Wissenschaftliche Forschung wurde im Untergrund mit geschmuggelten Instrumenten und Kontakt zum polnischen Untergrund außerhalb des Ghettos ebenfalls betrieben. Anhand des Beispiels der medizinischen Fakultät des Warschauer Ghettos wird die Funktion der Bildung für die unterschiedlichen Akteur*innen (Studierende, Dozierende, Forscher*innen) untersucht. Die Wahl, diese Fakultät zu untersuchen, erfolgte aufgrund der zwischen Legalität und Illegalität liegenden Struktur ihres Programms, der großen Anzahl an Studierenden und Dozierenden sowie der Verbindung von Lehre und Forschung. Die Studie zeigt außerdem, wie die zunehmende Radikalisierung der deutschen Besatzer auf die Bildungsfrage im Ghetto eingewirkt hat. Für die Quellenanalyse wurden hauptsächlich Tagebücher, Memoiren, transkribierte Interviews, Berichte von Überlebenden sowie Forschungsergebnisse benutzt. Damit wird ein Beitrag zur Debatte über „Widerstand“ und „Alltagserfahrung“ von Menschen, die als Juden definiert wurden, geleistet.
-
Caroline De Becker
Caroline De Becker
Foto: privatStudiengang: Anglistik/Amerikanistik (M.A.)
Betreuung durch Dr. Adam James Ross Tallman
Bewegung und Wahrnehmung von Raum und Zeit in der südamerikanischen Sprache Aymara
Die indigene südamerikanische Sprache Aymara, die hauptsächlich im Altiplano in Bolivien, Peru und Teilen von Chile gesprochen wird, konzeptualisiert Zeit anders. Während Sprachen wie Deutsch oder Englisch Zeit so wahrnehmen, dass die Zukunft vor uns liegt (z.B. the week is ahead of us) und die Vergangenheit hinter uns (z.B. the week is behind us), ist es das Gegenteil in Aymara. Die Zukunft (pacha qhipa, wörtlich: ‘Rückenzeit’) liegt hinter uns, während die Vergangenheit (pacha nayra, wörtlich: ‘Augenzeit’) vor uns situiert ist. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die Vergangenheit bereits erlebt wurde und deswegen „sichtbar“ ist und die Zukunft ist unbekannt und nicht „sichtbar“. Dies scheint ein einzigartiges Merkmal der Sprache zu sein. Das Ziel ist herauszufinden, wie Direktionalität, und damit verbunden, die Wahrnehmung von Raum und Zeit, in Aymara ausgedrückt wird.Kontakt:
caroline.de.becker@uni-jena.de -
Maximilian Grübsch
Studiengang: Kaukasiologie/Kaukasusstudien (M.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Diana Forker
Georgische Fremdwörter im Tschetschenischen: Gender-Assignment
Der, die oder das Nutella? Manchmal kommen selbst Muttersprachler:innen ins Stocken, wenn es um das richtige Genus von Fremdwörtern geht. Das Tschetschenische, eine im Kaukasus beheimatete und durch die Diaspora auch in Jordanien und Europa verbreitete Sprache, hat aber nicht nur drei, sondern gleich fünf bis sechs Genera (je nach Zählung). Eine tschetschenische Minderheit gibt es auch in Georgien. Das Georgische kennt kein grammatisches Genus. Deshalb ist es besonders interessant, wie Substantive aus dieser Sprache in den lokalen tschetschenischen Dialekt integriert werden – welche Strategien gibt es für die Zuordnung des Genus im Tschetschenischen? Dazu werden in Georgien Daten mit den Methoden der Feldforschung erhoben. Dies wird zum Verständnis der Entwicklung von Genus-Systemen im Sprachkontakt beitragen. -
Anika Sophie Hühn
Anika Sophie Hühn
Foto: privatStudiengang: Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts (M.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Bernhard Strauß
Zur Bilanzierung von Psychotherapieverfahren in der DDR. Qualitative Auswertung einer Interviewstudie
Das Gesundheitssystem der DDR war sowohl eine große Errungenschaft des sozialistischen Systems, die eine fast flächendeckende medizinische Versorgung ermöglichte, als auch eine von der Staatsführung stets besorgt beäugte Nische, der kritisches Denken und Abkehr vom Sozialismus vorgeworfen wurde. In besonderem Maße galt dies für die Psychotherapie, die sich in der DDR sowohl in Anlehnung an, als auch in Ablehnung zu westlichen Modellen entwickelte.
Der Forschungsverbund SiSaP – Seelenarbeit im Sozialismus untersucht im Teilprojekt Jena diese Entwicklung anhand einer Interviewstudie. Mein Forschungsvorhaben ist, der Bilanzierung der in der DDR ausgearbeiteten Therapieverfahren, durch eine qualitative Auswertung von Interviews mit ehemaligen Psychotherapeut*innen, gewidmet. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Untersuchung der Verzahnung von Politik, Wissenschaft und praktischer Arbeit. Die Arbeit fragt nach Vorbedingungen, möglichen Freiräumen und Hindernissen und nimmt verstärkt auch die Entwicklung der Psychotherapie im Spiegel der politischen Situation in den Blick.Kontakt:
anika.sophie.huehn@uni-jena.de -
Jonas Krause
Jonas Krause
Foto: privatStudiengang: Deutsch (Lehramt Gymnasium, Staatsexamen)
Betreuung durch Dr. Jens Ole Schneider
Bürgerlichkeit. Zur Ästhetisierung der neuen Mittelschicht in der Gegenwartsliteratur
Die gegenwärtige Popliteratur greift zunehmend Debatten um Identität auf. Neben race oder gender lässt sich in der Gegenwartsliteratur auch beobachten, wie gesellschaftliche Klasse thematisiert wird und dabei häufig ein Konzept ins Spiel kommt, welches gerade junge Menschen nicht einzuordnen wissen: Bürgerlichkeit.
Das Forschungsprojekt geht der Frage nach, inwiefern Bürgerlichkeit in der Gegenwartsliteratur ästhetisiert wird. Dazu müssen neue Tendenzen aus dem Bürgerlichkeitsdiskurs aufgegriffen werden, um den Begriff insbesondere auf mittelständische, nach Individualismus strebende Lifestylemilieus auszuweiten. Diese würden durch eigentlich subversive Lebensformen wie Veganismus oder Haltungen wie Ökologismus klassisch nicht als ‚bürgerlich‘ gelten, können durch ihre Rolle als kulturell prägende Mitte wohl aber als ‚bürgerlich‘ bezeichnet werden. Welche Darstellungsformen werden zur Ästhetisierung gefunden? In welchem Verhältnis stehen Kritik und Sprecherposition? Diese und weitere Fragen sollen in Bezug auf ausgewählte Werke beantwortet werden.Kontakt:
jonas.krause@uni-jena.de -
Aurelia Sophie Rohrmann
Aurelia Sophie Rohrmann
Foto: privatStudiengang: Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts (M.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Stefanie Middendorf
Transformationsprozesse rechter Gewalt und Männlichkeit. Eine Historisierung rechter Akteure, Netzwerke und Ideologien 1967-1977
Mit meinem Forschungsvorhaben möchte ich einen Beitrag zur Historisierung rechter Gewalt nach 1945 leisten. Dabei kommt dem Phänomen Männlichkeit eine konstitutive Rolle zu: Rechtsextreme Kameradschaften und Wehrsportgruppen gelten nicht ohne Grund als Männerbünde schlechthin. Auch die öffentliche Wahrnehmung und die mediale Berichterstattung untermauern vielfach das Stereotyp des männlichen Schlägers und Skinheads.
Daher möchte ich die Frage betrachten, ob ein stereotypisiertes Bild von rechter Männlichkeit den historischen Wirklichkeiten von 1967-1977 gerecht wird oder ob unterschiedliche, sich wandelnde Männlichkeitsentwürfe in Bezug auf rechte Gewalt von Bedeutung waren. Welche Rolle hat dabei Antifeminismus als reaktionäre Antwort auf die Emanzipationsprozesse der 68er und die zweite Frauenbewegung gespielt? Eine solche Analyse bietet das Potential, Geschlechtervorstellungen in der extremen Rechten in ihrer Genese besser zu verstehen und damit rechte Gewalt auf mögliche Ursachen hin zu untersuchen. -
Daniel Tahmazyan
Studiengang: Neuere Geschichte (M.A.)
Betreuung durch Prof. Thomas Kroll
Droysens Nationalstaat als Gottesstaat? Die theologischen Voraussetzungen der nationalen Geschichtsschreibung
Mein Projekt für das Honours-Programm beschäftigt sich mit den religiösen und politischen Überzeugungen des deutschen Historikers Johann Gustav Droysen. Droysen, der eine religiöse Person war und an die leitende Präsenz Gottes in der Geschichte glaubte, war der Meinung, dass der Nationalstaat ein unmittelbares Ziel der deutschen Nation sein sollte und, dass es die permanente Lösung für die Probleme war, die durch die Französische Revolution und die darauffolgenden napoleonischen Kriege ausgelöst wurden. Mit dem Versuch die Lücke zwischen seinen theoretischen und praktischen Ansichten zu schließen, wird sich meine Forschung mit den religiösen Vorrausetzungen der nationalistischen Historiographie des 19. Jahrhunderts befassen. Um die Verbindung zwischen Droysens religiösen Auffassungen und der historischen Mission, das heißt die Kreation des deutschen Nationalstaats für die er stand und die er repräsentierte, zu erklären, wird der theologischen Begriffs civitas dei (Gottesstaat) angewendet.Kontakt:
daniel.tahmazyan@uni-jena.de -
Karin Weihrater
Karin Weihrater
Foto: Martin GebhardtStudiengang: Romanistik, Slawistik (B.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Thomas Scharinger
Die Sprachlehre von Giovanni Battista de Pagani (1761) im Kontext der Italienisch-Lehrwerke im deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts
Gegenstand meines Forschungsprojekts ist die 1761 in Frankfurt am Main entstandene Sprachlehre Les vrais Fondemens & Principes de la Langue Itallienne […] von Giovanni Battista de Pagani – eine Italienisch-Grammatik, die trotz der Verwendung des Französischen als Metasprache an deutschsprachige Lerner gerichtet ist und von der nur ein einziges handschriftliches Exemplar überliefert ist. Da die Grammatik bislang noch nicht wissenschaftlich beschrieben wurde, werde ich mich intensiv mit dem im GSA in Weimar aufbewahrten Manuskript auseinandersetzen. Nach einer ersten inhaltlichen Erschließung des Werks soll es mit anderen Italienisch-Lehrwerken, die im 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum im Umlauf waren, verglichen werden. Dabei soll v.a. der Frage nachgegangen werden, ob und ggf. inwiefern sich Paganis Sprachlehre von anderen Italienisch-Grammatiken jener Zeit unterscheidet. Sind Unterschiede im Aufbau oder bei der Gewichtung der Inhalte feststellbar? Ist Paganis Grammatik innovativer? Oder hat er Teile aus anderen Grammatiken kopiert?
Kontakt:
karin.weihrater@uni-jena.de
-
Florentine Friedrich
Florentine Friedrich
Foto: privatStudiengang: Physik (B.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Torsten Fritz
Charakterisierung der optischen und strukturellen Eigenschaften des Moleküls 1,4,7,10-Tetra(tert-butyl)perylen auf dem 2D-Material Blauer Phosphor auf einer Goldoberfläche
Für die Entwicklung neuer elektronischer Bauteile sind organische Materialien vielversprechende Kandidaten. Bekannte Anwendungen, die es bereits zur Serienreife gebracht haben, sind beispielsweise organische Leuchtdioden (OLEDs), die heutzutage in vielen Fernsehern verbaut sind und es ermöglichen, die Geräte sehr dünn zu gestalten. In meinem Honours-Projekt untersuche ich im Rahmen der Grundlagenforschung ein System aus drei unterschiedlichen Materialien: Auf eine Goldoberfläche wird zunächst Blauer Phosphor und danach das organische Molekül TBPe aufgebracht. Der Blaue Phosphor ist ein sehr dünnes Material (etwa eine Million mal dünner als ein menschliches Haar), weshalb er auch als 2D-Material bezeichnet wird. Ein schon länger bekanntes 2D-Material ist Graphen, für dessen Erforschung Andre Geim und Konstantin Novoselov im Jahr 2010 den Nobelpreis für Physik erhielten. In dem von mir untersuchten System soll der Blaue Phosphor ungewollte Wechselwirkungen zwischen den TBPe-Molekülen und der Goldoberfläche verhindern.Kontakt:
florentine.friedrich@uni-jena.de -
Lukas Haßfurth
Studiengang: Physik (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Rainer Heintzmann
Ein Deep-Learning-basierter Ansatz für räumlich variierende Dekonvolution
Optische Instrumente können nicht beliebig kleine Strukturen in untersuchten Proben auflösen. Die Punktspreizungsfunktion (PSF) charakterisiert die Grenzen des Auflösungsvermögens optischer Instrumente. Im einfachsten Fall kann der Bildentstehungsprozess mathematisch durch eine Faltung beschrieben werden. Umgekehrt wird ein Algorithmus, der versucht, aus dem gemessenen Bild wieder die Probenstruktur zu ermitteln, als Entfaltung bezeichnet. Im realistischeren Fall einer PSF, die je nach Position im Sichtfeld variiert, muss die Faltung auf irgendeine Weise angenähert werden, und die Entfaltungsalgorithmen müssen entsprechend ausgefeilter sein, wodurch diese entweder langsamer werden oder mehr Annäherungen verwenden. Ein neuer, auf Deep Learning basierender Entfaltungsansatz verspricht sowohl hohe Genauigkeit als auch hohe Geschwindigkeiten. Wir versuchen, diesen neuen Ansatz zu verbessern, ihn auf eine Vielzahl von Mikroskopen anzuwenden und unsere Toolbox als Open-Source-Software zu veröffentlichen. -
Felix Hildebrandt
Felix Hildebrandt
Foto: privatStudiengang: Physik (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Christian Eggeling
Super-Resolution-Mikroskopie von Rezeptoren Natürlicher Killerzellen im nm-Bereich
Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) bilden einen wesentlichen Bestandteil des angeborenen Immunsystems. Sie überprüfen andere Zellen auf Virusinfektionen oder bösartige Veränderungen und leiten falls nötig den kontrollierten Zelltod in der Zielzelle ein. Es ist bereits bekannt, dass die Interaktion verschiedener Rezeptoren auf der NK-Zelle und Zielzelle für diese Entscheidungsprozesse verantwortlich sind. Bisher wurde jedoch der tatsächlichen räumlichen Anordnung der Granula (Teil der NK-Zelle) zu den Rezeptoren und ihr Einfluss auf den Entscheidungsprozess im Ganzen wenig Aufmerksamkeit zuteil. Der Grund hierfür sind die räumlichen Dimensionen, welche nicht mit klassischen Konfokal-Mikroskopen, sondern nur mit Super-Resolution-Mikroskopen aufgelöst werden können. Die Grundidee des Projekts besteht daher darin, die räumliche Anordnung dieser NK-Zell-Rezeptoren im aktivierten Zustand und den Einfluss von Inhibitoren der Immunantwort mit Hilfe modernster Super-Resolution-Mikroskope STED, STORM und MINFLUX zu untersuchen und hierfür Protokolle und Routinen zu entwickeln.Kontakt:
felix.hildebrandt@uni-jena.de -
Yash Pathak
Yash Pathak
Foto: privatStudiengang: Photonics (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Reinhard Geiß
Volloptisches Quantenexperimentkit mit modularem Design und Fernsteuerungsfunktionen zur Demonstration und Implementierung einheitlicher Operationen auf Koinzidenzbasis mit potenzieller Verallgemeinerung, um verschiedene grundlegende Quanteneffekte und ihre Anwendung auf die Quanteninformationsverarbeitung zu untersuchen
Die Quantenoptik ist aufgrund der inhärenten Robustheit der Polarisationsverschränkung gegenüber Dekohärenz nachweislich eine vielversprechende Technologie zur Implementierung von Quanteninformationsverarbeitungsalgorithmen (QIP). Quantenoptische Systeme waren weitgehend auf Labore beschränkt, was bisher ein Haupthindernis war, praktische Offline-/Online-Kurse auf der Grundlage dieser Technologie zu etablieren. Aber mit dem wachsenden Interesse an dieser Technologie ist es wichtig, modulare Erweiterungen zu entwickeln, die gegenüber Umweltfaktoren widerstandsfähig sind und mit minimalem Aufwand von überall aus ferngesteuert werden können. Zuverlässige verschränkte Photonenquellen auf Basis von SPDC in nichtlinearen Kristallen gibt es bereits von einigen Anbietern. Modulare Erweiterungen mit linearen optischen Elementen, die zum schnellen Testen von Hypothesen und generischen Ideen zur Quantenmechanik im Allgemeinen sowie QIP mit Optik verwendet werden können, wurden jedoch nach unserem Wissen noch nicht entwickelt. Ein solches System würde nicht nur für pädagogische Zwecke verwendet, sondern könnte auch auf Forschungsanwendungen angepasst werden. In diesem Projekt entwickeln wir modulare Erweiterungen, die universelle Einzel- und Zwei-Qubit-Quantengatter unter Verwendung von Interferometrie höherer Ordnung implementieren, und wir erstellen einen Machbarkeitsnachweis. -
Preethi Ramesh Narayan
Preethi Ramesh Narayan
Foto: privatStudiengang: Physik (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Christin David
Nichtlokale weiche Plasmonik in planaren homogenen Mehrschichtsystemen
Plasmonik ist die Untersuchung resonanter Wechselwirkungen zwischen den Elektronen im Leitungsband von Metallen und elektromagnetischer Strahlung. Diese Ladungsschwingungen finden sich auch in weicher Materie wie der geladenen ionischen Flüssigkeit in einer undurchlässigen Lipidmembran. Dadurch wird eine Brücke zwischen der Physik der harten Materie und der weichen Materie geschaffen. Wir untersuchen die Ladungsoszillationen schwerer Ionen in festen planaren Elektrolytsystemen. Neuartige theoretische Modelle werden entwickelt, um die Wechselwirkungseffekte von Ladungsträgern bei der Kommunikation von Nervenzellen und der Energieübertragung zwischen Elektrolyten und festen Grenzflächen zu untersuchen. Wir berücksichtigen auch nichtklassische Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern, die aufgrund starker räumlicher Beschränkung auf der Nanoskala auftreten. Diese Quantenwechselwirkungen werden im Rahmen semiklassischer Rechnungen mit besonderem Fokus auf Nichtlokalität in Ion-Ion-Wechselwirkungen untersucht, die über die klassische Elektrodynamik hinausgehen.
-
Hannah Alexa Geller
Hannah Alexa Geller
Foto: privatStudiengang: Humanmedizin (Staatsexamen)
Betreuung durch Prof. Dr. Dr. Christoph Redies
Statistische Bildeigenschaften und die ästhetische Wahrnehmung von abstrakter Kunst
In meinem Forschungsprojekt untersuche ich vergleichend abstrakte Kunst, die von Menschen gemalt oder von Computern erstellt wurde, und traditionelle Kunst des westlichen Bildkanons. Mit Hilfe eines Neural Style Transfer (NST)-Algorithmus übertrugen wir den Stil von verschiedenen abstrakten Originalgemälden auf computer-generierte, abstrakte Zufallsmuster. Ich analysierte zunächst die objektiven Bildeigenschaften der verschiedenen Bildkategorien (beispielsweise Farbeigenschaften, Kantenorientierungen oder Selbstähnlichkeit) und führte anschließend eine Bewertungsstudie mit 40 Versuchspersonen durch, in welcher ich nach verschiedenen ästhetischen Begriffen fragte (Gefallen, Harmonie, Interesse). Eines unserer Hauptergebnisse ist, dass computer-generierte Kunst insgesamt besser bewertet wird, wenn sie der traditionellen Kunst in ihren objektiven Bildeigenschaften ähnlicher ist. Bisher können wir außerdem 50-69% der Varianz der subjektiven Bewertungen mit den von uns gewählten Bildeigenschaften erklären und hierdurch verschiedene Rückschlüsse auf die Funktionsweise des NST-Algorithmus ziehen.Kontakt:
hannahalexa.geller@uni-jena.de -
Michael Reimann
Michael Reimann
Foto: privatStudiengang: Zahnmedizin (Staatsexamen)
Betreuung durch PD Dr. Ulrike Schulze-Späte
Die Rolle der therapeutischen Immunmodulation bei Parodontitis-assoziierten Knochenverlust
Durch Zunahme ernährungsbedingter Krankheiten wie bspw. Adipositas, Diabetes mellitus, Hypertonie, Herzinfarkt, Schlaganfall etc. richtet sich der Fokus heutiger Forschung im Laufe des demografischen Wandels hinsichtlich einer Primärprävention immer mehr auf den Zusammenhang unterschiedlicher Nahrungsfette mit der Entstehung und Progression dieser Krankheiten. Bisherige Forschungsergebnisse zeigen, dass Parodontitis, eine bakteriell bedingte, entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparates, ebenfalls mit dem Konsum fetthaltiger Nahrungsmittel korreliert und eine hohe Altersprävalenz aufweist. Demnach kann man schlussfolgern, dass die Inflammation und Progression der Parodontitis sowohl über Nahrungsfette modulierbar, als auch von alterungsspezifischen immunologischen Veränderungen abhängig ist. Hinsichtlich der unterschiedlichen oral lokalisierter Zelltypen soll der Fokus der Untersuchungen auf der zellulären Regulation der Wirtsantwort und der damit verbundenen Beeinflussung des parodontalen Knochenstoffwechsels liegen mit dem Ziel klinisch-relevante therapeutische Ansätze zu definieren.
Kontakt:
michael.reimann@med.uni-jena.de -
Anna Katharina Renner
Anna Katharina Renner
Foto: privatStudiengang: Molecular Medicine (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Susanne Jahreis
Analyse der Aktivierung und Migration von MAIT-Zellen als Reaktion auf eine pulmonare Aspergillus fumigatus Infektion im Menschen anhand des invasiven Aspergillose-on-Chip-Modells
Die Sporen des allgegenwärtigen Pilzes Aspergillus fumigatus werden im täglichen Leben ständig eingeatmet, jedoch bei gesunden Menschen wirksam von einem kompetenten Immunsystem eliminiert. Für immungeschwächte Patient:innen können die Sporen hingegen eine unmittelbare Bedrohung darstellen, da sie eine Krankheit mit hoher Mortalität, namens invasive Aspergillose, verursachen können.
Aufgrund von begrenzten Behandlungsmöglichkeiten ist es wichtig die Pathobiologie von Pilzinfektionen besser zu verstehen. Die erste Abwehr erfolgt durch das angeborene Immunsystem, gefolgt von einer robusten T-Zell-Antwort der adaptiven Immunität. Kürzlich wurde die Aktivierung von einem T-Zellsubtyp, den sogenannten Mukosa-assoziierten invarianten T (MAIT) Zellen, durch Pilze in in vitro Kulturen beschrieben.
Die Rolle von MAIT-Zellen in der antifungalen Immunität ist jedoch nicht vollends bekannt und wird daher in diesem Projekt mit Hilfe eines neuartigen, in-vivo-ähnlichen „Lunge-on-Chip“-Modells untersucht, welches die anatomischen Merkmale eines menschlichen Lungenbläschens widerspiegelt und es ermöglicht eine invasive Aspergillose nachzuahmen. -
Harini Keerthana Suresh Kumar
Harini Keerthana Suresh Kumar
Foto: privatStudiengang: Molecular Medicine (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Ignacio Rubio
Phänomen des Organversagens bei schweren Infektionen und Sepsis
Schwere Sepsis ist mit massiven Organschäden verbunden. Entzündlicher Stress kann direkt oder indirekt zu schweren Schäden an Geweben und Organen führen. So löst die Sepsis einen weit verbreiteten Zelltod als Folge der Entzündung aus. In vielen Fällen ist auch die Leber betroffen.
Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass Entzündungsschäden durch die Vorkonditionierung von Hepatozyten durch Kalorienrestriktion wirksam bekämpft werden können, aber es ist wichtig zu verstehen, wie der pro-inflammatorische Prozess Zellschäden und -tod auslöst. Der Mechanismus des Zelltods soll in immortalisierten Hepatozyten untersucht werden. Ein Schwerpunkt wird die Eingrenzung der intrazellulären Signalwege sein, die beim Zelltod ablaufen. Ein tiefer Einblick in die Art und Weise, wie die Entzündungskomponenten der Zelle das Signal zum Absterben geben, eröffnet die Möglichkeit, eine therapeutische Strategie zu finden und Organversagen zu verhindern.Kontakt:
harini.sureshkumar@uni-jena.de
-
Amina Aissaoui
Studiengang: Psychologie in Arbeit, Bildung und Gesellschaft (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Birk Hagemeyer
Das dynamische Zusammenspiel zwischen Einsamkeit und Feindseligkeit
Einsamkeit und Feindseligkeit wurden in der Theorie bereits in den 1930er Jahren miteinander assoziiert. Nichtsdestotrotz existiert bezüglich der Verbindung der beiden Phänomene wenig Forschung. Wenn ein Individuum einsamer wird als es üblicherweise ist, wird es dann auch feindseliger? Und andersherum? Diese und weitere Fragen stellte ich mir in meinem letzten HONOURS-Projekt. Und die Antwort: Ja, in drei großen Datensätzen (N ≈ 50.000) gibt es einen intraindividuellen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Feindseligkeit über die Zeit hinweg. Sind die beiden Phänomene jedoch auch kurzfristig miteinander verbunden? Wenn ich heute einsamer als üblich bin, bin ich dann morgen feindseliger? Und umgekehrt?
Solche und weitere Effekte möchte ich in diesem Projekt mithilfe einer Experience-Sampling-Methode betrachten.Kontakt:
amina.aissaoui@uni-jena.de -
Yona Bretschneider
Studiengang: Gesellschaftstheorie (M.A.)
Betreuung durch Prof. Carola Dietze
Geschichtstheorie der Alltagsgeschichte – Ein neues Paradigma im Spiegel seiner Kritik
-
Till Buchinger
Studiengang: Bildung - Kultur - Anthropologie (M.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Dr. Ralf Koerrenz
"Müssen wir unsere Technik verstehen?" Künstliche Intelligenz als Grenze der Autonomie
Autonomie ist traditionell ein pädagogisch relevantes Thema. Erfolgreiche pädagogische Praxis sollte Lernende dabei unterstützen, ihr eigenes Lernen selbstständiger zu organisieren. Die Reformpädagogin Maria Montessori beschrieb diese Zielsetzung treffend mit dem Spruch „Hilf mir, es selbst zu tun“. Diese Aufforderung stellt Pädagog*innen vor eine schwierige Aufgabe: Sie sollen Lernende dabei unterstützen, keine Unterstützung zu benötigen. Hinsichtlich des Themas Autonomie bedeutet das: Pädagog*innen greifen in die Autonomie von Lernenden ein, um deren Autonomie langfristig zu stärken. In Zeiten von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz bekommt diese Aufgabe eine neue Dimension. Digitaltechniken sind fester Bestandteil der Gesellschaft und so stellen sich zwei Fragen: Wie viel müssen Menschen über die Funktionsweise dieser Techniken wissen, um sich selbstbestimmt in der Infosphäre zu bewegen und wie kann man ihnen dabei helfen, diese Autonomie zu erreichen? -
Charlotte Friederike Dietel
Charlotte Friederike Dietel
Foto: privatStudiengang: Erziehungswissenschaft (B.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Nele Kuhlmann
Transformationserwartungen in der Ratgeberliteratur
Diskriminierungserfahrungen begleiten unser aller Alltag auf die unterschiedlichste Art und Weise. Dem gegenüber stehen Programme wie bspw. Ratgeber, die dazu anregen sollen, solche Situationen zu reflektieren und die Lesenden durch Wissen und Anleitung in ihrem Denken und Handeln zu unterstützen, sowie dieses in irgendeiner Form zu verändern. Unter anderem fordern Ratgeber dazu auf, sich selbst, Andere und die soziale Ordnung zu reflektieren. Doch wodurch zeichnen sich solche Reflexions- und Transformationserwartungen aus?
Dieser Frage möchte ich innerhalb des hier vorgestellten Forschungsprojekts nachgehen. Mittels einer qualitativen Diskursanalyse werden Ratgeber zu den Themenschwerpunkten Rassismus und Sexismus vergleichend analysiert. Das Ziel ist herauszuarbeiten wie sich die Leser*innenschaft zu ihrem eigenen Race und Gender, bzw. zu dem des Gegenübers verhalten sollen und welches Verständnis von Sensibilisierung damit einhergeht. Weiterhin soll betrachtet werden, wie die Lesenden adressiert werden und wie die Literatur die Bedingtheit dieser mitdenkt. -
Maria Ehnert
Maria Ehnert
Foto: privatStudiengang: Sozialkunde, Englisch, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Lehramt Gymnasium, Staatsexamen)
Betreuung durch Dr. Christoph Giesel
Antiarabischer Rassismus im deutschen Fluchtdiskurs: Die mediale Berichterstattung über syrische Geflüchtete und die damit einhergehende öffentliche Wahrnehmung im Vergleich zur ukrainischen Flüchtlingsbewegung
Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der medialen Berichterstattung über Syrien und SyrerInnen und die damit einhergehende öffentliche Wahrnehmung, sowie mit antiarabischem Rassismus in der deutschen Debattenkultur. Dabei wird im Rahmen einer diskursiven und komparativen Medienanalyse der Forschungsfrage nachgegangen, inwiefern sich im deutschen medialen Flucht- und Migrationsdiskurs eine Tendenz zur Xenophobie und zur Araberfeindlichkeit feststellen lässt und ob die deutsche Berichterstattung negative Stereotypen und Stigmata evoziert. In diesem Kontext soll geprüft werden, inwiefern die diskursiven Konstruktionen durch die deutsche Berichterstattung ausgewählter Print- und Onlinemedien der Tages- und Wochenpresse über ukrainische und syrische Geflüchtete divergieren. Bei der thematischen komparativen Analyse handelt es sich um eine Pionierforschung, bei der hochaktuelle und sich noch im Verlauf befindliche Ereignisse in Kombination mit bereits seit Jahren andauernden Prozessen von sehr hoher gesellschaftlich-politischer Tragweite und Relevanz untersucht werden (kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine versus in Syrien sowie anderen arabischen Staaten und daraus folgende Fluchtbewegungen nach Deutschland). -
Chantalle El Helou
Chantalle El Helou
Foto: privatStudiengang: Politikwissenschaft (B.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Michael Dreyer
Eine Analyse des Verhältnisses von modernem Antisemitismus und postmoderner Theorie
Der moderne Antisemitismus ist analytisch klar von Rassismus zu unterscheiden und zeichnet sich durch das zentrale Motiv des Juden als des Dritten aus, der als Zersetzer und Ursache allen Übels in einer eigentlich guten und vielfältigen Völkerwelt gedacht wird. Antisemitische Motive treten oft in indirekter Weise, nicht immer mit klarem Bezug und begrifflicher Nennung 'des Juden' auf. Unter den Angehörigen postmoderner Theorieströmungen (wie etwa Judith Butler in der Queer Theory oder Chantal Mouffe in der Radikalen Demokratietheorie) ist besonders israelbezogener Antisemitismus weit verbreitet. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob dieser Antisemitismus rein biographischer Natur oder bereits in der Theorie angelegt und damit eine Konsequenz der grundsätzlichen Gesellschaftsvorstellung und -analyse postmoderner Theorie ist. Findet sich in den Grundmotiven postmoderner Kritik also ein analytischer Antisemitismus? Dieser Frage soll anhand der Analyse der Argumentationsstruktur konkreter Texte, Klassiker postmoderner Kritik, nachgegangen werden. -
Julia Freitag
Studiengang: Psychologie (M.Sc)
Betreuung durch Prof. Dr. Franz Josef Neyer
Einsamkeitsdynamiken im Alltag, ihre Zusammenhänge zu Ereignissen im Alltag und affektiven Prozessen und Möglichkeiten der Intervention
In der Psychologie wird mit Einsamkeit ein subjektiv empfundenes qualitatives und/oder quantitatives Defizit in sozialen Beziehungen bezeichnet. Dieses subjektive Phänomen kann, aber muss nicht notwendigerweise mit objektiver sozialer Isolation einhergehen. Insbesondere über längere Zeiträume andauernde Einsamkeit hängt mit schlechterer körperlicher und psychischer Gesundheit zusammen. Jedoch ist noch nicht viel dazu bekannt, welche Bandbreite von alltäglichen Ereignissen Gefühle von Einsamkeit auslösen, wie sie das tun und wie diese Prozesse mit anderen affektiven Vorgängen zusammenhängen. Die Untersuchung dessen trägt zu einem besseren Verständnis von Einsamkeit und der arbeitenden Mechanismen in psychologischen Interventionen zur Reduktion von Einsamkeit bei. -
Cornelia Hartl
Cornelia Hartl
Foto: privatStudiengang: Psychologie (B.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Michaela Riediger
Der Zusammenhang zwischen Krisenerfahrungen und Empathischer Akkuratheit unter dem Aspekt des kriseninduzierten Wachstums.
Macht mich das Durchleben einer schwierigen Trennung oder der Tod eines geliebten Menschen zum Mentalisten?
Belastende Lebensereignisse gehen selten spurlos an einem vorbei. Doch können Krisen, die durch momentane Überforderung und einem Ohnmachtsgefühl gekennzeichnet sind, positive Effekte auf sozio-emotionale Kompetenzen haben? Vergangene Studien zeigten bereits, dass Menschen mit negativen Lebenserfahrungen verstärkt zur Perspektivübernahme neigen. Eine Fertigkeit, die für die Empathischen Akkuratheit, also die Fähigkeit Gedanken und Gefühle des Gegenübers korrekt zu lesen, vorausgesetzt wird.
Im Rahmen des Honours Programms möchte ich in einer Pilot-Studie untersuchen, inwiefern sich die Empathische Akkuratheit zwischen Menschen mit und ohne Krisenerfahrung unterscheidet und welche Rolle hierbei das kriseninduzierte Wachstum spielt. Die Empathische Akkuratheit soll mithilfe des Standard Stimulus Paradigm erhoben werden, bei dem die Probanden die Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonisten diverser Videos einschätzen.Kontakt:
cornelia.hartl@uni-jena.de -
Lena Mann
Lena Mann
Foto: privatStudiengang: Soziologie (M.A.)
Betreuung durch Dr. Robin Saalfeld
Eigentumsarrangements in Paarhaushalten – aus Klassenperspektive
Das Forschungsvorhaben befasst sich mit dem Strukturwandel von Eigentum in Paarhaushalten und dessen potentiellen Auswirkungen auf die innerpartnerschaftliche Arbeitsteilung und der Bedeutung von Eigentum für Geschlechterverhältnisse. Dabei werden die Eigentumsarrangements der Paare (doing property), aber auch die Paarkonstruktion (doing couple) im Zusammenspiel mit den jeweiligen Geschlechterkonstruktionen (doing gender) untersucht. Es geht nicht nur um die Verteilung von Eigentum zwischen den Partner*innen, sondern auch darum, welche Eigentumsobjekte Relevanz im Paarkontext besitzen, welche Bedeutung diesen beigemessen wird, wie diese verwaltet und verausgabt werden und wer welche Verfügungsrechte darüber hat. Ergänzen möchte ich die Differenzierungen zwischen den Paarhaushalten um eine Klassenperspektive. Mittels qualitativer Methoden liegt mein Fokus auf der vergleichenden Analyse der Eigentumsarrangements von Paarhaushalten verschiedener Klassenzugehörigkeiten, insbesondere mit Blick auf den Zusammenhang von Klasse und Geschlecht.Kontakt:
lena.mann@uni-jena.de -
Miriam Meuser
Studiengang: Psychologie (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Ilona Croy
Erstellung und Validierung eines Fragebogens zur Messung der Veränderungsmotivation in der Psychotherapie
Die Psychotherapieforschung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, dass die Wirksamkeit von Psychotherapie stärker von allgemeinen Wirkfaktoren beeinflusst wird als von spezifischen. Das Ziel dieses Projekts am Lehrstuhl für Klinische Psychologie ist es, die Veränderungsmotivation in der Psychotherapie als einen möglichen allgemeinen Wirkfaktor in Form eines Fragebogens zu operationalisieren sowie diesen zu testen und zu validieren. Die Veränderungsmotivation beschreibt inwieweit Patient:innen dazu bereit sind Veränderungen anzustoßen, um ihr Leiden zu überwinden. Bisher durchgeführte Studien zeigen, dass die Motivation der Patient:innen eine entscheidende Rolle in der Behandlung von psychischen Störungen spielt. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand liegt noch kein anerkanntes, veränderungssensibles und breit verwendetes Messinstrument zur Erfassung der Veränderungsmotivation im Psychotherapieprozess vor. Langfristig soll Forschung in diesem Feld dazu beitragen, herauszufinden welche Prozesse in einer Psychotherapie ablaufen und sich auf die Wirksamkeit auswirken.Kontakt:
miriam.meuser@uni-jena.de -
Lara Sophie Schießl
Studiengang: Psychologie in Arbeit, Bildung und Gesellschaft (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Antje Rauers
Reden ist Gold – Soziales Teilen von Emotionen und die Entwicklung von Nähe in queeren Partnerschaften
Erleben Menschen etwas Emotionales, haben sie anschließend das Bedürfnis, dieses Erlebnis anderen Menschen zu erzählen. Dieses Verhalten nennt man in der psychologischen Forschung „Soziales Teilen von Emotionen“. Es kann Nähe zwischen den beiden Personen fördern und zwischenmenschliche Beziehungen stärken. Das Soziale Teilen von Emotionen wird häufig in romantischen Beziehungen untersucht: Sind sich Paare, die ihre Emotionen häufiger teilen, besonders nah? Und ist dieses Verhalten besonders am Anfang einer Beziehung bedeutend oder bleibt es über die Jahre ähnlich wichtig? Queere Paare sind gerade in der psychologischen Paarforschung unterrepräsentiert. Deshalb will ich in meinem Projekt das Soziale Teilen von Emotionen bei gleichgeschlechtlichen Paaren untersuchen, um diese Unterrepräsentation zu adressieren und so Visibilität für queere Lebensrealitäten zu schaffen. Durch tägliche Befragungen will ich die Entwicklung von Nähe in Paarbeziehungen untersuchen und erforschen welchen Einfluss das Soziale Teilen von Emotionen auf diese Nähe hat.Kontakt
lara.schiessl@uni-jena.de -
Sina Wiese
Studiengang: Kognitive Psychologie und kognitive Neurowissenschaft (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Thomas Weiss, Dr. Roland Benoit, Dr. Philipp Paulus
Schematische Repräsentationen im medialen präfrontalen Kortex
Ich kann mir sehr genau vorstellen, wie es wäre, später mit meiner Freundin Lea in die Thulb zu gehen. Warum eigentlich? Wir nutzen unser Gedächtnis, um uns die Zukunft vorzustellen. Abstrahiert aus einzelnen Erinnerungen entstehen im Gehirn sogenannte Schemata von bestimmten Situationen. Sie ermöglichen es uns ähnliche Ereignisse in der Zukunft vorzustellen. Doch wie entsteht über einzelne Erinnerungen hinweg solch schematisches Wissen?
Roland Benoit erforscht in seiner Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut wie unser Gehirn es uns ermöglicht, uns zu erinnern und die Zukunft vorzustellen. Zusammen mit ihm und Philipp Paulus, einem ehemaligen Doktoranten der Arbeitsgruppe, untersuche ich, wie Schemata im medialen präfrontalen Kortex (mPFC) entstehen, mithilfe einer Fernsehserie. Versuchsteilnehmende lernen die Charaktere der Serie kennen, wodurch derartige schematischen Repräsentationen entstehen. Wie dies geschieht, untersuche ich mittels fMRT. Wir vermuten, dass sowohl strukturelles Wissen um die Beziehungen der Charaktere als auch deren affektiver Wert in den schematischen Repräsentationen im mPFC gespeichert werden.Kontakt:
sina.sophia.wiese@uni-jena.de -
Ellen Winkler
Ellen Winkler
Foto: privatStudiengang: Soziologie (M.A.)
Betreuung durch Prof. Dr. Kathrin Leuze
Atypische Berufsaspirationen von Mädchen und Jungen
Bereits im Grundschulalter zeigen Jungen und Mädchen bei der Frage nach ihrem Traumberuf geschlechtstypische Präferenzen. Dieses Phänomen zieht sich durch den Lebensverlauf und resultiert beispielsweise in der Unterrepräsentation von Frauen im männlich dominierten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften & Technik). Die frühe Förderung atypischer Aspirationen von Mädchen ist inzwischen ein wichtiges Thema in Forschung, Politik und Gesellschaft. Diverse Erklärungsfaktoren für typische und atypische Berufsaspiration von Mädchen sind bereits intensiv erforscht. Weit weniger ist hingegen bekannt über Aspekte, die verhindern oder befördern, dass Jungen sich für frauendominierte Berufe interessieren. In meinem Forschungsvorhaben verfolge ich daher einen bilateralen Ansatz. Zum einen befasse ich mich mit der Relevanz der Persönlichkeit für die atypische Aspiration von Mädchen im MINT-Bereich. Zum anderen nehme ich explorativ die maskuline atypische Aspiration in den Blick. Mein Projekt soll hervorheben, dass Förderung atypischer Aspirationen beider Geschlechter nötig ist, um Geschlechtergleichheit zu erreichen.Kontakt:
ellen.winkler@uni-jena.de
-
Marianne Böhm
Marianne Böhm
Foto: privatStudiengang: Geographie (M.Sc.)
Betreuung durch Dr.-Ing. Clémence Dubois
Erfassung von Waldstrukturparametern mit LiDAR und Radarfernerkundung
Wie Wälder strukturiert sind, beeinflusst beispielsweise ihre Funktion als Habitat und ihre Resilienz gegenüber Umweltveränderungen. Ich möchte zwei Typen von Datensätzen aus der Fernerkundung zusammenbringen, die für Waldstrukturparameter sensitiv sind: Radar und LiDAR.
Satellitengetragene Radarsensoren senden Mikrowellen aus und messen u.a. die Laufzeit und Intensität des zurückkommenden Signals. Die Nutzung verschiedener Frequenzbereiche ermöglicht es, unterschiedliche Komponenten der Anatomie des Waldes zu untersuchen: von der Oberfläche der Baumkrone bis hin zu den Stämmen. Somit kann die Kombination der Frequenzen erlauben, die Waldstruktur zu charakterisieren.
Um dies zu erreichen, muss jedoch zuerst untersucht werden, wie genau diese verschiedenen Frequenzen auf eine Reihe von Waldeigenschaften reagieren. Dies möchte ich im Rahmen des Honours-Programms erforschen, indem ich Laserscans als Referenz nutze. Diese LiDAR-Punktwolken bilden den Wald dreidimensional ab. Daraus können Strukturparameter berechnet werden, die ich mit den Radardaten vergleichen werde. Der regionale Fokus liegt dabei auf Thüringen.Kontakt:
marianne.boehm@uni-jena.de -
Muriel Bülhoff
Muriel Bülhoff
Foto: privatStudiengang: Geowissenschaften (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Kamil Ustaszewski
Gibt es eindeutige Evidenz für das Vorkommen von Pseudotachyliten (Reibungsschmelzen) entlang der Pustertal-Gailtal-Linie der Periadriatischen Störungszone?
Die Periadriatische Störungszone stellt eine dextrale (rechtslaterale) Blattverschiebungszone dar, welche aus der nordwestlich orientierten Bewegung der Adriatischen Platte gegenüber der Europäischen Platte resultiert und sich durch den gesamten Alpenbogen verfolgen lässt. Im östlichen Teil dieser Störungszone wurden deutlich weniger historische und instrumentelle Erdbeben aufgezeichnet als in den Regionen südlich der Störungszone. In meinem Projekt untersuche ich daher ein östliches Segment dieser Störungszone, die Pustertal-Gailtal-Linie, auf das Vorkommen von Pseudotachyliten, welche Erdbeben bezeugen. Durch Reibungshitze schmilzt bei ihrer Entstehung das Umgebungsgestein teilweise auf und erstarrt wieder zu amorphen Gläsern. Dazu führe ich eine geologische Kartierung in meinem Untersuchungsgebiet bei Maria Luggau im Lesachtal (etwa 15 km südlich von Lienz) durch. Außerdem analysiere ich Dünnschliffe, welche aus lokal entnommenen Gesteinsproben hergestellt wurden, mit dem Polarisationsmikroskop, dem Rasterelektronenmikroskop, Raman-Spektroskopie und Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse. Durch mein Projekt wird das tektonische Verständnis der Pustertal-Gailtal-Linie erweitert.Kontakt:
muriel.buelhoff@uni-jena.de -
Simon Franzen
Simon Franzen
Foto: privatStudiengang: Geoinformatik (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Alexander Brenning
Tallinn im 17. Jahrhundert – eine geodatenbasierte historische Modellierung
Tallinn (deutsch Reval, schwedisch Lindanäs) war im 17. Jahrhundert eines der wichtigsten urbanen Zentren im östlichen Ostseeraum. In der Stadt am Finnischen Meerbusen liefen Handelsströme aus Schweden, dem Baltikum, Finnland und dem russischen Raum zusammen. Das Leben in Tallinn wurde in dieser Zeit jedoch nicht nur durch einen regen Wirtschaftsbetrieb, sondern auch durch Tallinns Funktion als politisches und kulturelles Zentrum bestimmt.
In meinem Projekt möchte ich die verschiedenen raumhistorischen Dimensionen der Stadtgeschichte Tallins im 17. Jahrhundert mittels geoinformatischer Methoden visualisieren und analysieren. Als Produkte des Vorhabens sollen zwei digitale Karten entstehen, die die Stadt selbst und ihre politischen und ökonomischen Verflechtungen im Ostseeraum illustrieren werden. Das Projekt versteht sich nicht nur als Beitrag zur historischen Osteuropa- und Urbanitätsforschung, sondern auch als Verdeutlichung der Anwendungspotentiale von geoinformatischen Methoden für die Geistes- und Kulturwissenschaften.Kontakt:
simon.franzen@uni-jena.de -
Lucas Gregor
Studiengang: Chemie (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Ivan Vilotijevic
Entwicklung einer Totalsynthese von Mycofactocin und Derivaten
-
Leah Maria Hendrikje Haase
Studiengang: Chemie (B.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Ute Neugebauer
Spektroskopische Charakterisierung des Aktivierungszustandes von Monozyten nach gezielter Stimulation verschiedener Toll-like-Rezeptoren
Monozyten sind ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Immunsystems. Mithilfe von Rezeptoren können sie auf externe Stimuli reagieren und so Bakterien, Viren oder Teile dieser Pathogene (sogenannte Pathogen-assoziierte molekulare Muster, PAMPs) wahrnehmen. Zu diesen Rezeptoren gehören unter anderem Toll-like-Rezeptoren. Nach der Aktivierung durch PAMPs oder Pathogene verändern sich die Monozyten erheblich. Auf Basis der pathogen-spezifischen Aktivierungsprofile können Informationen über das eindringende Pathogen erhalten werden.
Im Rahmen meines Projektes stimuliere ich gezielt verschiedene Toll-like-Rezeptoren humaner Monozyten (THP-1-Zellen) mit PAMPs und charakterisiere die Aktivierungszustände der Monozyten mittels Raman-Mikroskopie. Dabei möchte ich mithilfe der Raman-Spektren die Unterschiede zwischen den nicht-aktivierten und den aktivierten Monozyten sowie zwischen den verschiedenen Aktivierungsprofilen untersuchen.Kontakt:
l.haase@uni-jena.de -
Corrie Mathiak
Studiengang: Geography: Climate and Environmental Change (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Alexander Tischer
Untersuchung oberflächennaher mikroklimatischer Bedingungen in einen Fichtenreinbestand im Stadtwald Hildburghausen und die Auswirkung von Totholz Anreicherung
Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Erhöhung der Artenvielfalt, zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und des Verjüngungserfolgs werden in einem gleichaltrigen Fichtenreinbestand im Stadtwald Hildburghausen untersucht. Im Vorfeld werden explorative Untersuchungen zu den mikroklimatischen Kenngrößen Wind, Wassergehalt und Temperatur räumlich und zeitlich hoch aufgelöst im Bestand durchgeführt. Anders als bei den meisten Mikroklimastudien im Wald liegt der Schwerpunkt auf oberflächennahen Messungen, d. h. auf dem Bereich, der für Sämlinge und Jungpflanzen bei der Waldverjüngung besonders wichtig ist. Auf diese erste Phase folgt eine experimentelle Phase, um die Auswirkungen von kleinräumigen Totholzanreicherungen auf diese mikroklimatischen Kenngrößen gezielt zu testen. Ziel ist es festzustellen, ob ähnliche Totholzanhäufungen als forstwirtschaftliche Praxis zur Verbesserung der mikroklimatischen Bedingungen am Waldboden und zur Erhöhung des Etablierungserfolges klimaresistenterer Baumarten im Zuge der Direktsaat dienen könnten. -
Verena Müller
Verena Müller
Foto: privatStudiengang: Chemie (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Andrey Turchanin
Selbstassemblierung von Ru(II)-Polypyridin-Komplexen auf Oberflächen für Anwendungen in der molekularen Photokatalyse
Die Erzeugung erneuerbarer Energien rückte in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus der Wissenschaft. In meinem Forschungsprojekt beschäftige ich mich mit der Synthese „künstlicher Blätter“. Hierbei soll die Photosynthese der Natur nachgeahmt werden. Als künstliches Blatt dient ein 2D-Material des Ruthenium(II)-Polypyridin-Komplexes, welcher photoaktiv ist. Die Synthese dieser „Blätter“ erfolgt in mehreren Schritten auf Goldoberflächen und ist mehrfach reproduziert im Zuge des TRR 234 „CataLight“ entstanden. Dabei wird zunächst aufgrund der koordinativen Wechselwirkung zwischen Gold und Carboxylgruppen eine unimolekular dicke, selbstassemblierte Monolage (SAM) erzeugt. Durch Vernetzung mit niederenergetischen Elektronen entsteht eine Kohlenstoffnanomembran (CNM). Zur Charakterisierung werden verschiedene Methoden der Oberflächenanalytik (z.B. AFM, REM, XPS) verwendet. Im Verlauf meines Forschungsprojekts soll der Bindungsmechanismus zwischen Gold und Carboxylgruppen mit einer speziellen Methode der „Polarisationsmodulation-Infrarot-Reflexions-Absorptions-Spektroskopie“ (PM-IRRAS) näher aufgeklärt werden. Des Weiteren soll die Synthese der SAMs auf Silberschichten optimiert werden, da dieses deutlich reaktiver ist als Gold.Kontakt:
verena.mueller@uni-jena.de -
Maximilian Prochnow
Maximilian Prochnow
Foto: privatStudiengang: Geographie, Deutsch (Lehramt Gymnasium, Staatsexamen)
Betreuung durch Prof. Roland Zech
Holozäne Feuchtigkeitsgeschichte des Schweizer Mittellandes anhand von Biomarker- und Stabilisotopenanalysen mit Sedimenten aus dem Moossee
Direkte paläohydrologische Proxies in den Alpen wurden bisher sehr selten angewendet. Die meisten Studien decken das gesamte Holozän (~11,7 ka) nur diskontinuierlich und in geringer zeitlicher Auflösung ab. Weitere Forschungen mittels quantitativer Proxies für paläohydrologische Veränderungen sind dringend erforderlich, um die Klimaveränderungen und ihre Auswirkungen auf das Ökosystem der Alpen während des Holozäns zu verstehen. In meinem Projekt konzentriere ich mich auf Seesedimente des Moossees (Schweiz) und untersuche dabei die komponentenspezifische Deuterium-Isotopie von sedimentären n-Alkan-Biomarkern (δ2Hn-Alkane), wobei ich das δ2H-Signal von terrestrischen und aquatischen n-Alkanen vergleiche. So liefert der isotopische Unterschied zwischen dem terrestrischen und dem aquatischen δ2H-Signal Informationen über vergangene Veränderungen der Feuchtigkeitsverfügbarkeit und der Verdunstung, da angenommen wird, dass das aquatische δ2H-Signal durch die Verdunstungsanreicherung des Seewassers gesteuert wird.Kontakt:
maximilian.prochnow@uni-jena.de -
Sascha Rudolph
Sascha Rudolph
Foto: privatStudiengang: Geowissenschaften (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Thorsten Schäfer
Der geogene Einfluss auf die Eutrophierungsproblematik am Laacher See (Osteifel, Rheinland-Pfalz) – Geochemische und mineralogische Untersuchungen von Phosphor- & Vanadium-haltigen Phasen in den Gesteinen des Laacher-See-Gebiets
Der Laacher See ist der wassergefüllte Kraterbereich des Laacher-See-Vulkans und zugleich der größte See in Rheinland-Pfalz, dessen Gewässerqualität durch einen hohen Phosphorgehalt gefährdet wird. Aufgrund der für stehende Gewässer hohen Phosphorkonzentration von durchschnittlich 31 µg/l, befindet sich der Laacher See an der Schwelle zur Eutrophierung, d.h. einem Nährstoffüberangebot von Phosphor für Organismen.
In meinem Projekt wird der geogene Eintrag von Phosphor und dem damit assoziierten Vanadium im Laacher See untersucht. Dieser umfasst die Lösung von Phosphatmineralen aus dem Gestein und der Anreicherung von Phosphor im Grundwasser. Insbesondere die vulkanischen Gesteine sind regional bedeutende Grundwasserleiter und bieten somit das Potential zur hydrochemischen Interaktion. Zur Erforschung des geogenen Eintrags werde ich die geochemische und mineralogische Zusammensetzung der Gesteine im Laacher-See-Gebiet mithilfe von Dünnschliffmikroskopie, RFA, Totalaufschluss und einer Elektronenstrahlmikrosonde erfassen, um die Phosphatgehalte in den Gesteinen zu bestimmen. Weiterhin werde ich die gesteinsspezifische Lösungskinetik von Phosphat mittels Elutionsversuchen ermitteln.Kontakt:
sascha.rudolph@uni-jena.de
-
Emil Brandenburg
Emil Brandenburg
Foto: privatStudiengang: Rechtswissenschaft (Medienrecht, Staatsexamen)
Betreuung durch Prof. Dr. Christian Alexander
Medienintermediäre und ihre Regulierung durch den Medienstaatsvertrag (MStV)
Medienintermediäre nehmen im 21. Jahrhundert eine wesentliche Rolle in der öffentlichen Meinungsbildung ein. Bei diesen handelt es sich um Diensteanbieter – typischerweise aus dem Internet – welche selbst keine Inhalte produzieren, sondern lediglich Inhalte Dritter auf der Basis von Algorithmen selektieren und der Öffentlichkeit präsentieren. Somit stellen Intermediäre gewissermaßen „Gatekeeper“ für die Inhalte und Meinungen dar, mit welchen Nutzerinnen und Nutzer im Internet konfrontiert werden. Damit nehmen sie eine sensible und für den demokratischen, offenen und unverfälschten Diskurs zentrale Rolle ein. Prominente Anbieter sind beispielsweise YouTube, Instagram oder Google.
Damit geht die Gefahr einher, dass die Algorithmen der Intermediäre manipuliert oder so gestaltet werden, dass bestimmte Inhalte rechtswidrigerweise diskriminiert werden, was zu einer Verzerrung des Meinungsbildes und Diskurses führen könnte. Um dies zu verhindern, sieht der neue Medienstaatsvertrag verschiedene Regelungen vor. Diese werden in meiner Arbeit hinsichtlich ihres Regelungszwecks, der Rechtsklarheit und ihrer speziellen Auslegungskriterien untersucht.
Dabei soll insbesondere untersucht werden, ob und wie die Regelungen den Ausgleich zwischen dem Interesse an einer unverfälschten öffentlichen medialen Meinungsbildung einerseits und dem ebenfalls berechtigten Interesse der Intermediäre an einer für sie vorteilhaften und idealen Selektion und Präsentation der Inhalte andererseits herstellen. -
Johannes Schlautmann
Studiengang: Rechtswissenschaft (Staatsexamen)
Betreuung durch Prof. Dr. Matthias Knauff
Sicherung der Daseinsvorsorge im Energiebereich unter Krisenbedingungen
In meinem Forschungsprojekt untersuche ich aus rechtlicher Perspektive, welche Herausforderungen sich im Bereich der Energieversorgung stellen, wie diese bewältigt werden können und was dabei vor dem Hintergrund der sich dynamisch entwickelnden Lage im Energiesektor zu beachten ist. Eine hinreichende Energieversorgung sicherzustellen, ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Dem Staat muss es, ausgehend von dem Erfordernis einer ständigen ausreichenden Verfügbarkeit von Energie, gelingen, auf die sich stellenden Herausforderungen im Energiebereich schnell und wirksam zu reagieren. Ausgehend von dem europa- und verfassungsrechtlich bedingten Rahmen, dem Ausgangspunkt der Untersuchung, gilt es en détail zu ergründen, wie die Energieversorgung unter Krisenbedingungen sichergestellt werden kann. Wesentlich dabei ist die Frage, wie die hierbei kollidierenden (verfassungsrechtlich bedingten) Rechtspflichten des Staates, einerseits im Zuge der Daseinsvorsorge den Zugang zu ausreichend Energie zu ermöglichen und andererseits einen größtmöglichen Umwelt- und Klimaschutz zu gewährleisten, miteinander in Ausgleich gebracht werden können.Kontakt:
johannes.schlautmann@uni-jena.de
-
Chunxiao An
Chunxiao An
Foto: privatStudiengang: Economics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Andreas Freytag
Wirtschaftliche Auswirkungen des Abschlusses eines EU-AUS-Freihandelsabkommens auf den Energiehandel
Zwischen der EU und Australien besteht ein dringender Bedarf an der Förderung des Freihandels im Energiesektor. Insbesondere seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist die Energieversorgung der EU angespannt. Daher ist es für die EU wichtig nach Alternativen mit erschwinglichen Preisen zu suchen, um weniger von russischen Gasexporten abhängig zu sein.
Als Beitrag zum Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Australien konzentriert sich meine Forschung darauf einen Zugang zu den potenziellen Auswirkungen im Energiebereich nach Abschluss des Freihandelsabkommens zu finden. Die Forschung schlägt außerdem Methoden zum Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen Australien und der EU vor. Berechenbare allgemeine Gleichgewichtsmodelle (CGE) werden angewandt, um Ursache-Wirkungs-Kanäle zu identifizieren, indem z.B. Energiepreise, Energieeinkommen und Handelsströme im Energiesektor simuliert werden.Kontakt:
chunxiao.an@uni-jena.de -
Suzanne Elena Bohnsack
Suzanne Elena Bohnsack
Foto: Natascha StolzeStudiengang: Business Administration: Spezialisierung in Strategy, Management and Marketing (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Peter Walgenbach
Ethnische Voreingenommenheit im Gesundheitswesen
Der Ärzt:innenmangel stellt eine ernsthafte Belastung für das deutsche Gesundheitssystem dar, die sich sowohl auf Ärzt:innen als auch auf Patient:innen auswirkt. Während die Immigration von Ärzt:innen, insbesondere aus Syrien und Rumänien, Potenzial zur Entlastung des Systems bietet, ist ethnische Diskriminierung in Deutschland immer noch ein aktuelles Thema. So können die Vorteile der Immigration, beispielsweise durch Vermeidung interethnischer Interaktion oder durch höhere Fluktuationsraten, ausgehebelt werden. Weiterhin haben Studien gezeigt, dass interethnische Interaktionen im Zusammenhang mit einer verminderten Behandlungsqualität und einer verringerten Befolgung ärztlicher Ratschläge stehen. Meine Forschung widmet sich der Frage, wie und welche Marketing-Instrumente gezielt dazu beitragen können, dass Patient:innen solche interethnischen Interaktionen eingehen. Erkenntnisse daraus können somit dazu beitragen, interethnische Interaktionen gezielt zu fördern und das deutsche Gesundheitssystem zu entlasten.Kontakt:
suzanne.bohnsack@uni-jena.de -
Michelle Hannemann
Michelle Hannemann
Foto: privatStudiengang: Wirtschaftspädagogik (M.Ed.)
Betreuung durch Prof. Petra Frehe-Halliwell
Reformpädagogik als Zugang zu einer Didaktik der Berufsausbildungsvorbereitung?
Viele Schulabgänger*innen scheitern im Anschluss an die allgemeinbildende Schule am unmittelbaren Übergang in eine Berufsausbildung. Sie landen im ‚Übergangssystem‘ des Berufsausbildungssystems, wo durch den Erwerb beruflicher Kompetenzen und allgemeinbildender Abschlüsse sowie Berufsorientierung an eine Berufsausbildung herangeführt wird. Besonderer Handlungsbedarf entsteht aus der großen Heterogenität der Schüler*innen (z.B. Personen mit Förderbedarf, Migrant*innen), die sich mit diversen Problemen, wie Perspektivlosigkeit oder Gewalterfahrung, auseinandersetzen müssen. Lehrende stehen vor der Herausforderung im Spannungsverhältnis der Zielsetzungen und individuellen Bedarfe ‚gute‘ didaktische Angebote zu entwickeln. Auch wenn sozial- und sonderpädagogische Zugänge bereits in diese Berufsausbildungsvorbereitungs-Didaktik einfließen, bleiben reformpädagogische Ansätze weitestgehend ausgeblendet. Die reformpädagogische Kernidee, Schule als Lern- und Lebensraum zur Persönlichkeitsentwicklung zu begreifen und zwischen individuellen und gesellschaftlichen Bedarfen zu vermitteln, lässt jedoch eine hohe Passung zu den Herausforderungen der Berufsausbildungsvorbereitung vermuten. Hier setzt mein Forschungsprojekt an: verschiedene Ansätze der Reformpädagogik (z.B. Jenaplan- oder Montessori-Pädagogik) werden auf Potenziale für die Didaktik der Ausbildungsvorbereitung analysiert und diskutiert.Kontakt:
michelle.hannemann@uni-jena.de -
Klara Lehmann
Studiengang: Economics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Silke Übelmesser
Die Beziehung von Geschlechternormen, haushaltsinterner Arbeitsteilung und der Zufriedenheit der Haushaltsmitglieder
Nach wie vor bestehen große Unterschiede („Gaps“) im Erwerbs- und Renteneinkommen von Männern und Frauen. Zu den zentralen Ursachen für die heute noch bestehenden Gaps in Erwerbs- und Renteneinkommen zählen Ausfallzeiten und kürzere Arbeitszeiten von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere aufgrund von Schwangerschaft, Kindererziehung, und weiteren Sorgearbeiten (Blau und Kahn 2017). Für mein Forschungsprojekt im Kontext des Honours-Programms möchte ich anhand eines Datensatzes des „Generations and Gender Survey“ für Deutschland in einem ersten Schritt die Rolle von soziodemographischen Faktoren wie beispielsweise Geschlecht, Einkommen, Bildungsgrad und politische Ausrichtung für Normvorstellungen zu Geschlechterrollen innerhalb des Haushalts untersuchen. In einem weiteren Schritt soll der Zusammenhang zur tatsächlichen Arbeitsteilung und der Angabe der Befragten zur Zufriedenheit mit dieser Arbeitsteilung hergestellt werden. Im Fokus meiner Analyse steht dann die Frage, wie sich eine Konvergenz der Normvorstellungen und der tatsächlichen Arbeitsteilung auf die Zufriedenheit der Haushaltsmitglieder auswirkt.Kontakt:
klara.lehmann@uni-jena.de -
Alyssa Marie Navarro Mahoney
Studiengang: Economics (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Olexandr Nikolaychuk
Analyse des Einflusses geschlechtsspezifischer Interaktionen auf das Lügenverhalten der Eltern
-
Jan Hauke Montag
Studiengang: Economics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Andreas Freytag
Globale Emissionszertifikat- Strategien als Instrument für eine effiziente Reduzierung des Klimawandels.
-
Emilie Neye
Emilie Neye
Foto: privatStudiengang: Economics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Matthias Menter
Die Rolle von Universitäten in sozialen Innovationsprozessen
In den vergangenen Jahren rückten neben technologischen Innovationen vermehrt soziale Innovationen in den Vordergrund, um sowohl integrative Wachstumsstrategien zu entwickeln als auch komplexe globale Herausforderungen zu bewältigen. Soziale Innovationen setzten sich zum Ziel, gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen und den Menschen innerhalb der Produktion zu integrieren. Ausgangspunkt ist das Erkennen jener Bedürfnisse und die darauffolgende Entwicklung von Problemlösungen. Studien haben gezeigt, dass in diesem Zusammenhang Universitäten eine zentrale Rolle zufällt, da sie sowohl Wissen bereitstellen als auch für den Transfer von Wissen verantwortlich sind und somit wiederum zum Entstehungsprozess sozialer Innovationen beitragen.
Innerhalb des Forschungsprojekts soll ein Index entwickelt werden, welcher soziale Aktivitäten im regionalen Kontext abbildet. Ziel des Projekts ist es, neue Erkenntnisse über die Rolle von Universitäten in sozialen Innovationsprozessen zu gewinnen und den Einfluss von Hochschulen auf die Entwicklung von sozialen Innovationen in einer Region darzustellen.Kontakt:
emilie.neye@uni-jena.de -
Anna Katharina Thünte
Anna Katharina Thünte
Foto: privatStudiengang: Economics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Matthias Menter
Akademische Gründerinnen: Herausforderungen, Potentiale und Handlungsbedarfe
Die Rolle von Hochschulen hat sich im Zeitverlauf gewandelt. Die traditionellen Aufgaben Lehre und Forschung wurden um den Transfer von Forschungsergebnissen sowie die kommerzielle Verwertung dieser erweitert. Diese Ausweitung des Aufgabenfeldes von Hochschulen begründet sich dadurch, dass die in der Hochschulforschung gewonnen Erkenntnisse für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, wie bspw. des Klimawandels oder des demographischen Wandels, von großer Bedeutung sind. Um diesen Herausforderungen angemessen entgegen treten zu können, müssen die Hochschulforschungsergebnisse daher der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Eine Möglichkeit dieses Wissens- und Technologietransfers sind akademische Ausgründungen - Unternehmensgründungen, die durch Forschende vorgenommen werden. Da diese Unternehmensgründungen seltener durch Akademikerinnen erfolgen, soll mein Forschungsprojekt dazu beitragen, die Hintergründe hinter der geringen Anzahl akademischer Gründerinnen zu verstehen. Das Ziel des Forschungsprojektes ist es, die Herausforderungen und Potentiale akademischer Gründerinnen und die sich daraus ergebenden Handlungsbedarfe für (universitäre) Institutionen zu identifizieren. -
Yasmine Ziedi
Yasmine Ziedi
Foto: privatStudiengang: Economics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Silke Übelmesser
Die Auswirkungen der Kontaktqualität auf Zuwanderung und politische Einstellungen: Eine empirische Untersuchung in Deutschland.
In meinem Forschungsprojekt möchte ich untersuchen, wie die Art des Kontakts mit
Zugewanderten die Meinungen über Zuwanderung und das Wahlverhalten in Thüringen beeinflusst. Es gibt mehrere Theorien, die Hypothesen über den Ursprung von Vorurteilen gegenüber Eingewanderten aufstellen, wie z. B. die Theorien der Gruppenbedrohung, der imaginierten Deprivation und des Kontakts. Ich möchte mich auf die Kontakttheorie konzentrieren. Der Datensatz, mit dem ich arbeiten möchte, ist ein Fragebogen, der 2019 im Rahmen des WOM-Projekts erhoben wurde und von 1000 Personen (ab 16 Jahren, wohnhaft in Thüringen) beantwortet wurde. Dieser Fragebogen bietet umfassende Einblicke in den Kontakt mit Zugewanderten, Meinungen über Zuwanderung und das Wahlverhalten. Er enthält insbesondere drei Fragen zu Kontakten mit Zugewanderten: in der Familie und im engen Freundeskreis, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft. Ich möchte diese Selbsteinschätzungen verwenden, um Indizes für die Art des Kontakts zu definieren und zu berechnen, da es interessant wäre zu untersuchen, ob der Kontakt in verschiedenen Umfeldern die Meinungen über Einwanderung und das Wahlverhalten beeinflusst. Diese Fragen wurden bereits empirisch untersucht, allerdings getrennt voneinander (z. B. Andersson et al., 2021; Ellison et al., 2011, usw.). Der mir zur Verfügung stehende Datensatz ermöglicht es mir, alle diese Effekte gleichzeitig zu untersuchen.
-
Jan Blunk
Studiengang: Informatik (M.Sc.)
Betreuung durch Dr.-Ing. Paul Bodesheim
Biodiversitätsmonitoring in der Bildverarbeitung – Active Learning und Human-in-the-Loop-Ansätze zur Unterstützung des visuellen Monitorings
Biodiversitätsveränderungen quantitativ zu erfassen ist eine große Herausforderung, die durch automatisierte Systeme unterstützt werden kann. Im Rahmen des AMMOD-Projektes werden dazu mit Hilfe von Kamerafallen Wildtierbilder gesammelt, bei denen die Tierarten automatisch erkannt werden sollen. Um die dazu benötigten Modelle aus dem Bereich des maschinellen Lernens zu trainieren, müssen Domain-Experten sehr viele Beispielbilder mit den korrekten Tierarten annotieren.
Um den Annotationsaufwand zu minimieren, wird das Modell schrittweise trainiert, wobei in jedem Schritt automatisch die optimalen Daten zur Annotation ausgewählt werden sollen – das bezeichnen wir als „Active Learning“. Ich arbeite daran, verschiedene Strategien hierfür zu entwerfen und diese in ein Programm zur Bildannotation einzubinden. Da wir ständig neue Daten von den Kamerafallen erhalten, lässt sich hier so der vollständige Prozess des kontinuierlichen, lebenslangen Lernens abbilden.
-
Anna Baborski
Studiengang: Biochemie/Molekularbiologie (B.Sc.)
Betreuung durch Dr. Anne Busch
Genomische Analyse von Darmbakterien aus Sepsispatienten
Das Darmmikrobiom spielt eine große Rolle im menschlichen Körper. Diese kommensalen Bakterien unterstützen den Menschen bei der Nahrungsaufnahme oder der Synthese wichtiger Vitamine oder kurzkettigen Fettsäuren. Zusätzlich sind sie auch in der Lage das Immunsystem zu beeinflussen. Eine Dysbalance des Darmmikrobioms kann zu vielen verschiedenen Krankheitsbildern, wie z.B. dem Fatigue Syndrom, Depressionen oder auch kognitiven und motorischen Störungen führen.
Nach einer Sepsis, welche eine Infektionskrankheit mit folgendem Organversagen ist, die meist mit hohen Dosen Antibiotika behandelt wird, werden auch die Bakterien des Darms getötet. Einige Bakterien können jedoch überleben. Sind diese potenziell pathogen, so können diese ursächlich für sekundäre Infektionen des Wirts sein. Mittels einer genomischen Analyse verschiedener überlebender Isolate aus einer Sepsispatientin sollen die Gene, welche den Mechanismen, die zum Überleben nötig sind, sowie Virulenzfaktoren untersucht und mögliche Therapietargets gefunden werden.Kontakt:
anna.baborski@uni-jena.de -
Maria Eduarda Dienstmann Appel
Studiengang: Evolution Ecology and Systematics (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Omer Nevo
Die Evolutionsökologie von Fruchtreife
Die Ernährungsentscheidungen frugivorer Tiere sind für Pflanzen entscheidend. Da viele Pflanzenarten für die Verteilung ihrer Samen auf Frugivoren angewiesen sind, behauptet die Hypothese des Samenverbreitungssyndroms, dass der Selektionsdruck der Frugivoren die Evolution der Fruchtmerkmale bestimmt hat. Basierend auf der Reifungsphysiologie werden fleischige Früchte in klimakterisch (KL) und nicht-klimakterisch (NK) unterschieden. Während KL-Früchte die Atemfrequenz und Ethylenproduktion erhöhen und auch nach der Loslösung von der Pflanze reifen, weisen NK-Früchte keine dieser Eigenschaften auf und reifen nur in Verbindung mit der Pflanze. Ich werde testen, ob Früchte, die von Bodenfrugivoren verbreitet werden, wahrscheinlicher KL- und solche, die durch Baumfrugivoren verbreitet werden, wahrscheinlicher NK-Früchte sind. Um zu prüfen, ob KL/NK tatsächlich Teil des Samenverbreitungssyndroms sind, werde ich zudem andere Fruchtmerkmale, wie beispielsweise die Samengröße, auf ihren Zusammenhang hinsichtlich der KL/NK-Merkmale untersuchen. -
Alla Govor
Studiengang: Evolution Ecology and Systematics (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Solveig Franziska Bucher
Veränderungen in der taxonomischen Diversität der Vegetation im Laufe der Sukkzession auf aufgelassenen Weinbergen
-
Gaurvanshi Gupta
Gaurvanshi Gupta
Foto: privatStudiengang: Microbiology (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Daniela Röll
Übersprechen von peripheren mononukleären Blutzellen mit Pseudomonas aeruginosa Biofilm
Pseudomonas aeruginosa ist ein bakterieller Erreger und häufiger Verursacher chronischer und schwer zu behandelnder Infektionen der Lunge (Lungenentzündung), von Wunden und Haut, insbesondere bei immungeschwächten Patienten. Die von diesem Organismus verursachte Infektion wird nach der Biofilmbildung, bei der es sich um eine in die Matrix eingebettete Aggregation der Bakterienzellen handelt, fast unmöglich zu behandeln. Das Biofilmkompartiment wirkt als Barriere sowohl gegen antimikrobielle Behandlung als auch gegen Immunantworten, was zu therapeutischem Versagen und Rückfallen, weiteren Infektionen anderer Körperteile, Morbidität und erhöhter Letalität führt.
Die menschliche Immunantwort auf P. aeruginosa-Biofilme ist ein Forschungsgebiet, das noch wenig erforscht ist. Mein Ziel ist es, die Aktivitäten im Biofilm nach der Exposition gegenüber verschiedenen Immunzellen (Zelllinien) zu analysieren und die Bakterien zusätzlich mit Antibiotika zu belasten. Das etablierte Modell könnte auf den Prozess der Chronifizierung von Pseudomonas aeruginosa-Biofilmen hinweisen. Es könnte helfen, Ideen zu gewinnen, wie man die Kommunikation innerhalb des Biofilms blockieren kann oder wie man Immunzellen stimuliert, um diesen Prozess zu verhindern. Diese Arbeit kann helfen, Biomarker zu finden, um Biofilm von Planktonic Infektion zu unterscheiden.Kontakt:
gaurvanshi.gupta@uni-jena.de -
Jurij Kintz
Studiengang: Biochemistry (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Diana Riebold
Optimierung der Pneumocystis jirovecii Kultur sowie ihrer weiteren Aufbereitung für Massenspektrometrie und Next Generation Sequencing
Der humanpathogene Pilz Pneumocystis jirovecii (P. jirovecii) kann bei immunsupprimierten Patienten eine schwere Pneumocystis-Pneumonie auslösen. Diese stellt eine der häufigsten Todesursachen bei HIV-Patienten mit fortgeschrittenem AIDS dar. Trotz seiner medizinischen Relevanz ist heutzutage wenig über P. jirovecii bekannt und es herrscht ein Mangel an valider Labor-Diagnostik. Die erfolgreiche Kultivierung von P. jirovecii stellt hierbei den Flaschenhals der Pneumocystis-Forschung und auch der Entwicklung neuer Diagnostik dar. Das Ziel des Projektes ist die weitere Optimierung der weltweit ersten, in der Arbeitsgruppe Host Septomics etablierten, P. jirovecii Langzeitkultivierung. Hierbei sollen die Auswirkungen von wichtigen Spurenelementen untersucht werden.
Des Weiteren wurden in der Arbeitsgruppe und im vorliegenden Projekt mittels Massenspektrometrie P. jirovecii-spezifische Zielstrukturen gefunden, die für die Entwicklung von monoklonalen Antikörpern für Schnelltestsysteme genutzt werden sollen. Die Vorbereitung von Kulturproben für diese Analyse sowie Sequenzierungen wird durch die starke Clusterbildung des Organismus gestört. Im Projekt sollen unterschiedliche Methoden der Cluster-Auflösung miteinander verglichen werden. -
Nils Krommer
Nils Krommer
Foto: privatStudiengang: Biologie (B.Sc.)
Betreuung durch Dr. Alexander Steossel
Vergleichende morphologische Integration des Innenohrs und des Endocraniums innerhalb der Felidae und Canidae
Ein Charakteristikum der Natur ist es, dass Lebewesen in allen Aspekten ihres Daseins variieren. Von dieser Variation nicht verschont sind die nächsten Verwandten der Hunde (Canidae) und der Katzen (Felidae). Ich möchte mich in diesen Verwandtschaftsgruppen mit der Formenvielfalt des Innenohrs und dem Teil des Gehirns beschäftigen, welches direkt an den Schädel angrenzt.
Ziel ist es hierbei, Grundmuster, Variationen und Besonderheiten beim Aufbau dieser Strukturen zu identifizieren und miteinander zu vergleichen. Zusätzlich gilt es zu klären, ob sich die Gestalt des Gehirns und des Innenohrs unabhängig voneinander entwickelt und verändert hat, oder nicht. Die gewonnenen Erkenntnisse hierzu werden das anatomische und morphologische Verständnis über die Evolution, Art- und Individualentwicklung der Canidae und Felidae erweitern und neue Erklärungsansätze im Hinblick auf Funktionalität und Variabilität eröffnen.Kontakt:
nils.krommer@uni-jena.de -
Yannik Leistner
Yannik Leistner
Foto: privatStudiengang: Pharmazie (Staatsexamen)
Betreuung durch Dr. Andreas Winter
Photobasische Metallkomplexe
Was sind photobasische Metallkomplexe?
Die Bezeichnung verrät es zum Teil: Es werden Licht (Photo-), Basen und Metallkomplexe zusammengebracht. Durch Lichteinstrahlung können diese Komplexe, wie zum Beispiel Eisen umgeben von stickstoffhaltigen organischen Ringen, angeregt werden – dies bedeutet, dass Elektronen ihren normalen Energiezustand verlassen und in einen Energiereicheren übergehen. Durch diese Reaktion, verändert sich das Verhalten des Moleküls zu Wasserstoff – die Wasserstoffaffinität wird erhöht. Folglich, wenn ein solcher Komplex Wasserstoff an sich bindet, wirkt dieser als Base – er ist ein photobasicher Metallkomplex.
Wie können photobasische Metallkomplexe eingesetzt werden?
In der Synthesechemie werden in vielen Reaktionen Basen eingesetzt. Man stelle sich vor, dass zwei Moleküle miteinander verbunden werden sollen – was mithilfe von Basen geschehen kann. Mit Photobasen wäre es möglich den basischen Effekt durch die Lichtbestrahlung der Lösung zu erzeugen (Lichtschalter an) und diesen durch unterlassene Lichtbestrahlung zu verringern (Lichtschalter aus).
Das Ziel der Forschung ist es, organische Metallkomplexe zu synthetisieren, welche im sichtbaren Bereich angeregt werden und die Prozesse dahinter zu charakterisieren. -
Simran Madaan
Simran Madaan
Foto: privatStudiengang: Molecular Life Sciences (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Aria Baniahmad
Analyse der überlebensfördernden Androgenrezeptor-AKT-Signalgebung bei Androgen-vermittelter zellulärer Seneszenz von Prostatakrebszellen.
In westlichen Ländern ist Prostatakrebs die am häufigsten diagnostizierte bösartige Erkrankung und die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache bei Männern. Der Androgenrezeptor (AR) steuert das Wachstum sowohl der normalen Prostata als auch des Prostatakrebses. Die Hormonbehandlung der ersten Wahl, die Androgendeprivationstherapie (ADT) und die auf den Androgenrezeptor (AR) gerichtete Therapie, sind beide anfänglich wirksam, führen jedoch häufig zu einer Therapieresistenz, indem überlebensfördernde Signalwege aktiviert werden, am häufigsten der PI3K-AKT-Signalweg. Da berichtet wurde, dass eine starke Unterdrückung der AR-Signalgebung durch AR-Antagonisten eine reziproke Aktivierung von PI3K-AKT verursacht, kann eine duale Hemmung mit ADT und PI3K-, AKT- oder mTOR-Inhibitoren zu einer stärkeren Hemmung des Wachstums von Prostatakrebs führen. Dies kann zu besseren therapeutischen Behandlungen für Prostatakrebs führen. Aber, um dies zu erreichen, muss ein besseres Verständnis der Wechselwirkungen zwischen AR-Akt sowie der Wirkung verschiedener Antagonisten und Akt-Inhibitoren auf diese Wechselwirkung etabliert werden, was das Ziel meines Honours-Projekts ist.
Kontakt:
simran.madaan@uni-jena.de -
Marco Patrzek
Studiengang: Evolution, Ecology and Systematics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Christine Römermann
Vergleichende Analyse von Phänologiemustern krautiger Arten auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen
Der Kontext für dieses Honours-Projekt sind zwei bereits bestehende Forschungsprojekte des Deutschen Zentrums für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv): die „PhenObs“-Initiative und das Citizen Science-Projekt „Pflanze KlimaKultur!“. Forschungsziel beider Projekte ist es, die Auswirkungen des Klimawandels auf krautige Pflanzenarten zu untersuchen, insbesondere auf deren Phänologie und funktionelle Merkmale. Während „PhenObs“ ein international agierendes Netzwerk an botanischen Gärten ist, welches diese Auswirkungen bei über 200 Arten auf makroklimatischer Skala von Trondheim bis Rom untersucht, analysiert „Pflanze KlimaKultur“ die mikroklimatischen Veränderungen bei 10 ausgewählten heimischen Arten innerhalb der Stadtgebiete von Berlin, Halle, Jena und Leipzig.
Das Ziel dieses Honours-Projektes ist es nun, diesen beiden unterschiedlichen räumlichen Skalen eine dritte zeitliche Skala hinzuzufügen. Durch das Heraussuchen aller Herbarbelege ausgewählter Arten im Herbarium Haussknecht kann so ein Blick in die phänologische Vergangenheit geworfen werden. Mit Hilfe der daraus extrahierten Daten können beispielsweise Aussagen über verschobene Blütezeiten und artspezifische Unterschiede der Pflanzenmerkmale getroffen werden. Der finale Schritt findet dann in einer vergleichenden Analyse aller drei Datensätze statt, um phänologische Muster bei krautigen Arten auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen zu vergleichen und einen neuartigen Blickwinkel in der Erklärung artspezifischer Pflanzenmerkmale zu erhalten. -
Bolaji John Samuel
Bolaji John Samuel
Foto: privatStudiengang: Microbiology (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Oliwia Makarewicz
Charakterisierung von Phagen aus menschlichen Proben.
Bakteriophagen (Phagen) sind hochspezifische bakterielle Viren, die entweder einen lytischen oder einen lysogenen Zyklus durchlaufen können. Nach der Invasion nutzen virulente Phagen den Stoffwechsel des Wirts, um sich zu vermehren und das Wirtsbakterium zu lysieren, wobei sie im lytischen Zyklus weitere Virionen vermehren. Im lysogenen Zyklus integrieren gemäßigte Phagen ihr Genom nach der Invasion in das Genom des Wirts. Ziel meines Projekts ist die Untersuchung, Isolierung, Reinigung und Charakterisierung von Phagen aus menschlichen Proben. Dieses Projekt wird neue, gut charakterisierte Phagen für zwei weitere wichtige laufende Projekte am IIMK liefern: i) Die Rolle von Phagen und Prophagen bei der Pathogenität und Therapie von Mukoviszidose (TIPAT, EU-finanziertes Innovating Training Network) und ii) Die therapeutischen Eigenschaften von Phagen zur Dekolonisierung des menschlichen Darms von multiresistenten Enterobakterien. -
Felix Späth
Studiengang: Microbiology (M.Sc.)
Betreuung durch Dr. Kathrin Fröhlich
Regulation von Antibiotikaresistenz durch nicht-kodierende RNAs im humanpathogenen Bakterium Klebsiella pneumoniae.
Klebsiella pneumoniae ist ein Gram-negatives Enterobakterium und Teil der normalen Darmflora des Menschen. Als opportunistisches Pathogen kann es jedoch in anderen Regionen des Körpers als Krankheitserreger auftreten und besonders bei immungeschwächten Patienten zum Auftreten von Harnwegsinfektionen, Pneumonien und sogar Sepsis führen. Neben diesen klassischen Stämmen gibt es aber auch hypervirulente und multiresistente K. pneumoniae Stämme, die auch bei gesunden Personen schwerwiegende und oft lebensbedrohliche Krankheiten auslösen können. K. pneumoniae setzt viele verschiedene regulatorische Mechanismen ein, um sich an die Umgebung des Wirtes anzupassen und die Wirkung von Antibiotika zu umgehen. Besonders die Regulation auf Ebene der RNA wurde in diesem Zusammenhang noch wenig erforscht. Die wichtigste Klasse bakterieller regulatorischer RNAs, die sogenannten kleinen nicht-kodierenden RNAs, können die Expression einer Ziel-mRNA positiv oder negativ beeinflussen. Durch diesen schnellen und präzisen Regulationsmechanismus kann das Bakterium auf veränderte Umweltbedingungen, wie z.B. Antibiotika reagieren und die Genexpression entsprechend anzupassen. Ein besseres Verständnis spezifischer und universeller regulatorischer Wege, die zur Multiresistenz von K. pneumoniae beitragen, ermöglicht die zukünftige gezielte Auswahl und Weiterentwicklung eingesetzter antibakterieller Wirkstoffe. Aus diesem Grund möchte ich in meinem Forschungsprojekt sRNAs identifizieren und charakterisieren, deren Aktivität die Antibiotikaresistenz des Bakteriums beeinflussen. -
Diana Spurite
Studiengang: Evolution, Ecology & Systematics (M.Sc.)
Betreuung durch Prof. Dr. Dr. h.c. Martin S. Fischer
Sammlung von Stimuli und Bewertung der emotionalen Interaktionen und Mimik von Schimpansen (Pan troglodytes verus).