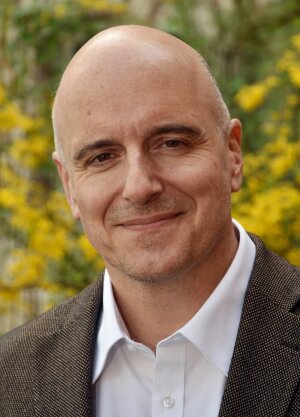Neuberufene 2017
Herzlich Willkommen!
-
Miriam Agler-Rosenbaum
Mehr erfahrenExterner LinkAgler Rosenbaum
Foto: Jan-Peter Kasper (Universität Jena)Auf dem Flur vor Miriam Agler-Rosenbaums Büro riecht es noch nach frischer Farbe, in ihrem Büro stehen große Kartons. Die Bauarbeiten in der obersten Etage des Biotechnikums sind in ihren letzten Zügen, die Handwerker verpassen den renovierten Räumen den letzten Feinschliff. Vom Bürofenster aus ist eine weitere Baustelle zu sehen. Zwei marode Laborhäuser werden abgerissen, bald entsteht an ihrer Stelle das neue Biotech Center des Leibniz-HKI. Die 38-jährige Professorin wirkt inmitten des Chaos der Baustellen wie ein Gegenpol: klar und strukturiert.
Vor über einem Jahr kam der Ruf der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Miriam Agler-Rosenbaum übernahm zeitgleich auch die Leitung des Biotechnikums am Leibniz-HKI. "Da stand ich plötzlich vor der Aufgabe, ein ganzes Haus zu managen", erzählt sie. Doch die zweifache Mutter vermittelt unweigerlich den Eindruck, dass sie solchen Herausforderungen nicht nur unerschrocken gegenübertritt, sondern sie vielmehr aktiv herbeiführt: "Ich habe schon immer die Augen offen gehalten und nicht erst kurz vor knapp überlegt, wie es weitergeht", sagt sie.
Das verdeutlicht auch ein Blick in ihre Vergangenheit: Nach ihrem Biochemie-Studium an der Universität Greifswald bekam Agler-Rosenbaum noch während ihrer Promotion eine Postdocstelle an der Washington University in St. Louis (USA) angeboten. "Da hatte ich noch ein halbes Jahr, um meine Promotion zu Ende zu bringen. Das war nicht viel Zeit. Aber diese einmalige Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen", sagt sie. Trotz der Entfernung zu ihrer Heimat arbeitete sie weitere Jahre an der Cornell University im Bundestaat New York. Schließlich ging es von Übersee wieder zurück in heimischere Gefilde – wenn auch noch weit entfernt von ihrer Heimat – nach Aachen. Dort war sie bis 2017 Juniorprofessorin für Mikrobiologie von definierten Mischkulturen. "An der Uni in Aachen liegt der Schwerpunkt eher auf den Ingenieurwissenschaften. Daher war der Wechsel nach Jena sehr interessant. Hier spielt Mikrobiologie eine ganz große Rolle, so dass man sich hier wissenschaftlich viel besser entfalten kann", sagt Agler-Rosenbaum.
Auch in der Wissenschaft bewegt sie sich gerne auf weitgehend unbekanntem Terrain. In ihrem Haus – wie Agler-Rosenbaum das Biotechnikum häufig nennt – findet sie gute Bedingungen vor. "In meinem Forschungsfeld entdecke ich beinahe jeden Tag etwas Neues. Es ist sehr abwechslungsreich und genau das fasziniert mich an Mikroorganismen", schwärmt Agler-Rosenbaum. Den Fokus legt sie dabei auf bioelektrochemische Systeme und definierte mikrobielle Mischkulturen. "Ich untersuche also zum einen, wie Mikroorganismen mit Hilfe von elektrischem Strom chemische Stoffe herstellen. Andere wiederum können wir zur Stromerzeugung nutzen – was als umweltverträgliche Energiequelle der Zukunft interessant ist", erklärt sie. Zum anderen untersuche sie mikrobielle Mischkulturen. Das Zusammenspiel mehrerer Mikrobenarten berge große Chancen, neue Substanzen zu entdecken, die auch für den Menschen nutzbar sein können. Mit diesem anspruchsvollen biotechnologischen Ansatz weicht Agler-Rosenbaum von der üblichen Forschung an Reinkulturen – nur eine Spezies, die kultiviert und erforscht wird – ab. Damit übernimmt sie auch im neuen Exzellenzcluster "Balance of the Microverse" der Universität Jena eine Vorreiterrolle.
Neben ihren eigenen Themen ist sie als Leiterin des Biotechnikums darauf bedacht, biotechnologische Prozesse zu optimieren, um möglichst große Mengen an Wirkstoffen aus den Mikroorganismen zu gewinnen. Diese werden zunächst erforscht und dienen später bestenfalls der Herstellung von Medikamenten. Zudem trägt sie die Verantwortung für ein großes, hochqualifiziertes Team von wissenschaftlichem und technischem Personal. Gemeinsam mit ihrem Team bearbeitet sie mehrere Industrieprojekte und baut neue Kooperationen auf, durch die neben dem Erkenntnisgewinn auch der Wissenstransfer in die Praxis gewährleitet wird.
"Nicht nur beruflich war der Weg nach Jena die richtige Entscheidung", sagt Agler-Rosenbaum. Sie genieße die Energie und die Bewegung, die in Jena zu spüren sei. Auch die Nähe zu ihrem Elternhaus sieht sie als großen Vorteil: "Wir können am Wochenende einfach spontan zu meinen Eltern fahren. Die freuen sich natürlich immer, ihre Enkelkinder zu sehen."
-
Valeska Bopp-Filimonov
Mehr erfahrenExterner LinkProf. Dr. Bopp-Filimonov
Foto: FSUDenomination: Romanistik
mit Schwerpunkt Rumänistikzuvor: Studienstiftung des deutschen Volkes
-
Wiebke Brose
Mehr erfahrenExterner LinkWiebke Brose
Foto: FSU"Es ist viel Bewegung im Sozialrecht und es hat große Bedeutung für unsere Gesellschaft", nennt Prof. Dr. Wiebke Brose, LL.M. von der Friedrich-Schiller-Universität Jena zwei Gründe, warum sie dieses Rechtsgebiet so begeistert. Aber der neuen Lehrstuhlinhaberin für Bürgerliches Recht und Sozialrecht ist auch bewusst, "dass die Regeln so komplex sind, dass viele Leistungen nicht mehr ankommen, weil es kaum jemand versteht. Und das schürt Unzufriedenheit". Die Gesetze und Regelungen zu "übersetzen" und ein besseres Verständnis zu erreichen, dem widmet sich die 42-jährige gebürtige Emsdettenerin in Forschung und Lehre. Dabei macht es die Politik der Juristin nicht einfach, unterliegt doch kaum ein anderes Rechtsgebiet so raschen Änderungen. Denn, nennt Prof. Brose ein Beispiel, die permanenten Reformen des Elterngeldes resultieren auch daraus, dass die jeweils herrschende Politik damit ihr Familienbild rechtlich steuern will. Ihre Aufgabe als Rechtswissenschaftlerin sieht die Neu-Jenaerin darin, "diese rechtlichen Veränderungen kritisch-objektiv zu betrachten".
Dialogorientierte und praxisnahe LehreDafür sei sie gerne an die Friedrich-Schiller-Universität gewechselt, sagt Brose, da hier das Sozialrecht noch ein eigenständiges Fachgebiet ist und die Rechtswissenschaftliche Fakultät mit einer guten Infrastruktur, inklusive Bibliothek aufwarten könne. Zuvor war sie an der Universität Duisburg-Essen in der Bildungswissenschaftlichen Fakultät tätig, wo sie v. a. Pädagogen und Erziehungswissenschaftlern das Sozialrecht nahegebracht hat. Dies hat besonders ihre Art der Lehre beeinflusst, die dialogorientierter und noch praxisnäher wurde – wovon jetzt die Jenaer Studierenden profitieren.
Wiebke Brose hat Rechtswissenschaft in Köln und an der Sorbonne in Paris studiert und mit der Maitrise en droit/LL.M. abgeschlossen. Diesen grenzüberschreitenden Aspekt hat sie auch in ihrer Dissertation "Der präventive Kündigungsschutz bei betriebsbedingten Kündigungen – Vergleich von Entwicklung und Stellenwert im deutschen und französischen Kündigungsrecht" verfolgt. Dabei wurde ihr u. a. sehr deutlich, dass für Arbeitgeber in Frankreich Kündigungen noch teurer sind als in Deutschland. Die 2014 in Köln fertiggestellte Habilitation untersucht "Die Haftung für Verkehrspflichtverletzungen und unternehmerische Tätigkeit – die Auswirkung von Pflichtdelegationen im Unternehmen".
In Jena will Prof. Brose v. a. im Sozialrecht weiter forschen. Dabei gehören Suchterkrankungen ebenso zu ihren Spezialthemen wie das Recht behinderter Menschen auf Arbeit, Elterngeld, Sozialversicherungsrecht und die Frage des Anpassungsbedarfs der Sozialversicherung an die veränderte Arbeitswelt. Auch das jüngst reformierte Mutterschutzgesetz, das nun ebenfalls auf Studentinnen Anwendung findet, gehört zu ihren Schwerpunkten. "Mutterschutz ist spannend, weil es ein modernes Thema ist", begeistert sich die Mutter eines achtjährigen Sohns. Und viele Studentinnen werden ihr vielleicht einmal dankbar sein, wenn geklärt werden kann, wie ihre Zeit im Mutterschutz bei der Rente mitberechnet wird – allerdings wird sich die frankophile Wissenschaftlerin dieser Frage forschend und nicht in Einzelberatungen widmen, weist sie auf die Grenzen des Möglichen hin. (AB)
-
Liuchun Deng
Denomination: Strukturwandel und Produktivität
zuvor: Johns Hopkins University (USA)
-
Carola Dietze
Denomination: Neuere Geschichte
zuvor: Universität Gießen
-
Christian Eggeling
Mehr erfahrenExterner LinkChristian Eggeling
Foto: FSUZu Lebzeiten von Ernst Abbe machten die besten käuflichen Mikroskope mit sichtbarem Licht bereits Strukturen knapp unter 200 Nanometer sichtbar. Diese bemerkenswerte Leistung ist in der Gegenwart dank technischem Fortschritt und dem Einsatz von scannenden Verfahren noch weiter verbessert worden. Heutzutage ermöglichen es moderne Mikroskopsysteme, in Zellkerne oder -membranen hineinzusehen und die dort ablaufenden Prozesse am einzelnen Molekül zu beobachten.
Möglich wurde dieser Fortschritt durch technische Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, an denen Prof. Dr. Christian Eggeling seit Mitte der 1990er Jahre Anteil hat. Den neuen Professor für hochaufgelöste Mikroskopie (Superresolution Microscopy) berief die Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT). Der Wissenschaftler hat sich der Fluoreszenzmikroskopie verschrieben - eine Methode mit der es möglich ist, räumliche und zeitliche Mechanismen auf molekularer Ebene zu untersuchen.
Mit höchster Genauigkeit molekulare Interaktionen darstellenMit der Verbesserung der Detektion von Einzelmolekülen hat sich der in Soltau aufgewachsene Eggeling nach einem Physikstudium in Hamburg und Göttingen bereits in seiner Promotion beschäftigt, die er im Jahr 2000 am Max-Planck-Institut (MPI) für biophysikalische Chemie und der Uni Göttingen beendet hat. Was folgte, war mehr als ein „Ausflug“ in die Wirtschaft. Beim Pharma- und Biotech-Unternehmen Evotec in Hamburg entwickelte er unterschiedliche Anwendungen für die Fluoreszenzmikroskopie und lernte dort nicht nur Projekt-orientiertes Arbeiten, sondern „verlor auch die Berührungsängste zu Biologie und Medizin“. Dies kam dem sportlichen Wissenschaftler zugute, als er 2003 zu Prof. Dr. Stefan Hell, der 2014 den Nobelpreis für Chemie erhielt, zurück ans Göttinger MPI kam und dort hochauflösende Fluoreszenzmikroskopietechniken mitentwickelte. „Wir haben gezeigt, dass es funktioniert, mit höchster Genauigkeit molekulare Interaktionen darzustellen“, fasst Prof. Eggeling die produktiven neun Jahre zusammen.
Seine Expertise brachte ihm einen Ruf an die Universität Oxford ein, auf eine Professur für Molekulare Immunologie verbunden mit der Leitung des dortigen Wolfson Imaging Centre. Neben der Weiterentwicklung der Mikroskopietechniken hat er diese dort auch verstärkt in die Medizin überführt. Wichtig sei es, „zuzuhören, was die Partner brauchen und intensiv miteinander zu reden“, sagt der 47-Jährige. „Wir müssen lernen, was wir noch verbessern können. Und dafür ist das Gespräch mit den Anwendern extrem wichtig“, so Eggeling, der auch an 13 Patenten beteiligt ist.
Eine personifizierte Brücke
Dieses Credo will der verheiratete Vater zweier Kinder auch in Jena leben. Dass er aus Oxford an die Saale wechselte, hängt vor allem mit Jena zusammen: „Für mich steht Jena für optische Mikroskopie“, sagt er lächelnd und freut sich, jetzt auch räumlich in der Tradition Abbes arbeiten zu können. Dass er nach Jena gewechselt ist, ist auch dem gemeinsamen Einsatz der Leitungen von Universität, Leibniz-IPHT, Physikalisch-Astronomischer Fakultät sowie der Medizinischen Fakultät zu verdanken, betont Prof. Eggeling.
Und Eggeling baut hier nicht nur die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, Abbe und Schiller, Universität und Leibniz-IPHT bzw. außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Wissenschaft und Wirtschaft, Deutschland und England, sondern auch zwischen Physik und den Lebenswissenschaften. Denn an FSU und Leibniz-IPHT ist er direkt in der Physik angesiedelt, doch seine Forschungen haben vor allem „die Optimierung der Mikroskopietechniken für die Life Sciences“ zum Ziel. Zudem will er die Methodik zu einem Diagnostiktool weiterentwickeln, um z. B. noch einfachere Untersuchungen von Rezeptoren und Membranen zu ermöglichen. Dass er damit in Jena offene Türen einrennt, habe er bereits vor seiner Rufannahme gemerkt. Die Sprecher vieler Sonderforschungsbereiche aus Medizin und Naturwissenschaften hätten rasch mit ihm das Gespräch gesucht und deutlich gemacht, dass er gebraucht werde - ein weiterer Grund für die Rufannahme. Jetzt ist Christian Eggeling vor Ort, wenngleich er auch weiterhin regelmäßig in Oxford forschen wird, um Brücken zu bauen zwischen den Disziplinen. Und solche „Brücken spannen“ will der Neu-Jenaer auch in der Lehre: In die Physik möchte er mehr Biophysik bringen und bei den Studierenden ein „Feuer entfachen“ für die benachbarten Disziplinen. (AB)
-
Jörg Ganzenmüller
Jörg Ganzenmüller
Foto: Norman Hera"Mich interessiert, auf welche Weise politische Ereignisse oder Umbrüche auf den Menschen wirken", sagt Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller von der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU). Alltagsgeschichte, die Interaktion zwischen Menschen, interessiert den neuen Professor für Europäischen Diktaturenvergleich. Er versteht Menschen als Akteure, deren Handeln die Strukturen und Ereignisse verdeutlichen, wenn er über Krieg, Diktaturen, Gewalt und Ideologien, aber auch über Erinnerungskultur und Sportgeschichte forscht.
Dies hat der heute 47-jährige gebürtige Augsburger, der in Freiburg/Brsg. Geschichte und Politikwissenschaften studiert hat, bereits in seiner Dissertation über die deutsche Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg deutlich gemacht. Er belegte, dass es kein Ziel der deutschen Wehrmacht war, die sowjetische Stadt einzunehmen, sondern sie dem Erdboden gleichzumachen. Für diese Einordung der Belagerung in den deutschen Vernichtungskrieg wurde er zu seiner Überraschung stark von russischen Historikern kritisiert – da er seine Schlussfolgerungen durch zahlreiche Quellen untermauern konnte, hielt Ganzenmüller die Kritik gut aus, lernte dabei allerdings viel über die Unterschiede in der europäischen Erinnerung an das 20. Jahrhundert.
Stiftung und Wissenschaft enger verknüpfenDas kam dem kulturinteressierten Wissenschaftler, der 2004 als Postdoc an die Uni Jena wechselte, immer wieder zugute. Zuletzt besonders 2014, als er als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Ettersberg berufen wurde, nachdem er zuvor Förderstipendiat am Historischen Kolleg in München und nach seiner Habilitation 2010 in Osteuropäischer Geschichte auch Lehrstuhlvertreter in Jena war. Als Vorstandsvorsitzender ist es sein "Ziel, Stiftung und Universität enger zu verzahnen" und die Forschung "als gleichberechtigte Säule der Stiftungsarbeit auszubauen". In seiner neuen Doppelfunktion kann er dies ideal umsetzen. Überdies will er die Stiftung Ettersberg mit der Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt enger mit den "big playern" der Zeitgeschichte in Thüringen – der Gedenkstätte Buchenwald, dem "Imre Kertész Kolleg Jena" und dem "Jena Center. Geschichte des 20 Jahrhunderts" – verknüpfen.
Sportgeschichte als politische Sonde"Das 20. Jahrhundert wirkt bis heute nach", betont Prof. Ganzenmüller und macht deutlich, dass er – trotz seines Schwerpunkts im letzten Jahrhundert – auch gerne über aktuelle Fragen diskutiert. So steht für den fußballbegeisterten Wissenschaftler beispielsweise fest, dass die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar "einen handfesten politischen Nutzen" für den Wüsten-Staat hat. Sportgeschichte ist für ihn eine Sonde, um allgemein-politische Fragen zu stellen und zu untersuchen.
Seine Erkenntnisse beruhen auf einem fundierten Quellenstudium, das er auch seinen Studierenden an der Friedrich-Schiller-Universität näherbringen will. Am wertvollsten ist ihm aber, "dass sie selbstständiges Denken lernen" – auch hier ist ihm der einzelne Mensch sehr wichtig.
-
Carsten Hoffmann
Mehr erfahrenExterner LinkCarsten Hoffmann
Foto: UKJDer Chemiker und Pharmakologe Prof. Dr. Carsten Hoffmann hat seit diesem Sommersemester die Professur für Molekulare Zellbiologie am Universitätsklinikum Jena inne und leitet das gleichnamige Institut im Centrum für Molekulare Biomedizin der Friedrich-Schiller-Universität am Beutenberg. Zur Erforschung der Signalprozesse in der Zelle untersucht er die Funktion von Rezeptoren und Proteinen mit modernster Bildgebung.
Signalprozesse in der Zelle in Echtzeit abbildenErst durch trickreiche Serienfotografien ließ sich vor 150 Jahren bestätigen, dass Pferde beim Galoppieren alle vier Beine gleichzeitig vom Boden lösen - mit diesem Vergleich beschreibt Prof. Dr. Carsten Hoffmann seinen Ansatz, die Signalprozesse in der Zelle in Echtzeit abzubilden, um sie zu verstehen. "Mit modernsten Bildsensoren, ausgefeilter Auslesetechnik und spezifischen Markierungstechniken können wir eine zeitliche Auflösung im Millisekundenbereich erreichen und quasi beim Schalten von Rezeptoren und Binden von Proteinen zuschauen", so der 50-jährige Chemiker, seit diesem Sommersemester Professor für Molekulare Zellbiologie am Universitätsklinikum Jena und Direktor des gleichnamigen Instituts.
Dabei konzentriert sich das Interesse auf die Funktion sogenannter G-Protein-gekoppelter Rezeptoren, einer großen Familie von Membranproteinen, die an einer Vielzahl von Reizverarbeitungsprozessen beteiligt und Andockstelle für 30 % der pharmazeutischen Wirkstoffe ist. Hoffmann: "Wir studieren die Effekte potenzieller Arzneimittel an diesen Proteinen und verfolgen nachgeschaltete Signalketten im Detail. Diese Signalwege sind nicht linear, sondern hochgradig vernetzt." Die Knotenpunkte dieses Netzwerkes bilden Proteine, die mehrere Funktionen übernehmen können. So konnte Carsten Hoffman mit seiner Würzburger Arbeitsgruppe zeigen, dass ein bestimmtes Protein nicht nur die Aktivität der betrachteten Membranrezeptoren reguliert, sondern dabei selbst aktiviert wird und als Signalstoff fungiert, was es auch als Angriffsort für pharmazeutische Substanzen interessant macht.
Nach seinem Chemiestudium in Bremen wurde Carsten Hoffmann im Bereich der Bioorganischen Chemie der Universität Bremen promoviert und forschte anschließend mit einem John Fogarty Stipendium in der Molecular Recognition Section des National Institutes of Heath in den USA. Er hielt sich vielfach als Gastwissenschaftler in Frankreich und den USA auf und leitete eine Arbeitsgruppe am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Würzburg, wo er sich habilitierte und seit 2012 eine Professur für Mikroskopie der Signaltransduktion am Rudolf-Virchow-Zentrum innehatte.
Über seine Mitarbeit im Sonderforschungsbereich ReceptorLight hat Prof. Hoffmann schon sehr gute Kontakte zu Jenaer Wissenschaftlern, "und das Institut ist als Abteilung des Zentrums für Molekulare Biomedizin der Universität bestens etabliert, das erleichtert mir den Start immens." Das ermöglicht ihm auch, langsam in die Koordination des Masterstudienganges Molekulare Medizin hineinzuwachsen, die in seinem Institut liegt. An Erfahrung in der Studierendenausbildung mangelt es dem ehemaligen Lehrkoordinator am Würzburger Institut nicht, der auch in der forschungsorientierten Linie des Medizinstudiums mitarbeiten möchte. "Unser Engagement in den Lehrveranstaltungen ist der kürzeste Weg, den wissenschaftlichen Nachwuchs für unsere Forschungsthemen zu interessieren und für die Mitarbeit in unseren Laboren zu gewinnen", so Prof. Hoffmann nicht uneigennützig. (vdG)
-
Steve Hoffmann
Mehr erfahrenExterner LinkSteve Hoffmann
Foto: FSUDie wachsende Bedeutung von Hochdurchsatz-Methoden in der Molekularbiologie erfordert auch den Ausbau statistischer und mathematischer Methoden zur Analyse der Forschungsergebnisse. Die Vielzahl an Ansatzpunkten für die Datenanalyse bei gleichzeitig geringer Anzahl der Proben macht es notwendig, sich auf Methoden des maschinellen Lernens und statistische Verfahren zur Interpretation von Daten zu stützen. Mit Steve Hoffmann konnte das FLI einen ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet gewinnen. Er hat zunächst in Marburg und Göttingen Medizin studiert und begann 2001 parallel mit einem Informatikstudium, das er nach Abschluss der medizinischen Prüfungen in Hamburg mit der Spezialisierung auf Bioinformatik fortführte. Die Promotion in Medizin erfolgte 2007, in Bioinformatik 2014. In den Jahren 2007 bis 2009 forschte er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität Leipzig. Dort übernahm er 2009 die Leitung der Juniorgruppe "Transcriptome Bioinformatics" am Interdisziplinären Zentrum für Bioinformatik und dem Forschungszentrum für Zivilisationskrankheiten der Uni Leipzig, in dem er auch als gewählter Vertreter der Nachwuchswissenschaftler agierte. Seit Oktober 2017 ist er nun als Leiter der Forschungsgruppe "Bioinformatik für Alterungsprozesse" am FLI sowie als Professor für Computational Biology an der Friedrich-Schiller-Universität Jena tätig. (PM)
-
Jutta Hübner
Mehr erfahrenExterner LinkJutta Hübner
Foto: privatÜber die Hälfte der Krebspatienten versucht neben der vom Arzt verordneten Strahlen- oder Chemotherapie auch pflanzliche Stoffe, Nahrungsergänzung oder Naturheilmittel, die in bunten Zeitschriften angepriesen oder in Online-Erfahrungsberichten positiv bewertet werden. Bei den Brustkrebspatientinnen liegt dieser Anteil noch weit höher. "Für die Wirksamkeit der ergänzenden Mittel oder Methoden gibt es nur minimale Nachweise, und oft erfährt der behandelnde Arzt nichts von dieser Selbstbehandlung", nennt Prof. Dr. Jutta Hübner gleich zwei zentrale Probleme dabei. Die Internistin hat seit diesem Jahr die Professur für Integrative Onkologie am Universitätsklinikum Jena inne, die die Deutsche Krebshilfe als Stiftungsprofessur an der Klinik für Innere Medizin II eingerichtet hat und für fünf Jahre fördert und die direkt an das Universitätstumorzentrum angebunden ist.
Vor allem in der Onkologie, aber auch bei anderen chronischen vielschichtigen Krankheitsbildern ist der Bedarf an ergänzenden oder alternativen Behandlungsmöglichkeiten sehr groß - vor allem, wenn man körperliche Aktivität, Psychoonkologie oder Selbsthilfegruppenarbeit mit dazu zählt. "Und die komplementäre Medizin hat durchaus das Potenzial, den Patienten zu helfen", so Hübner. Als Beispiele zählt sie Ingwer gegen die Übelkeit bei Chemotherapie auf oder Yoga und leichten Sport zur Abmilderung des Erschöpfungszustandes Fatigue. Neben qualitativ hochwertigen Studien fehlt es vor allem an fundierten Informationen über komplementäre Behandlungsmöglichkeiten, sowohl bei den Patienten, als auch bei den Ärzten.
Möglichkeiten und Risiken komplementärer MedizinHier will Prof. Hübner, die zuvor eine Informationsdatenbank der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe aufgebaut hat, mit einem niederschwelligen Angebot ansetzen. In regelmäßigen Vorträgen für Krebspatienten, Angehörige und Interessenten wird sie am Uniklinikum Jena über die Möglichkeiten und Risiken komplementärer Medizin informieren. In der Patientenversorgung führt sie die Arbeit der Ambulanz für Naturheilkunde und Integrative Onkologie an der Klinik für Innere Medizin II fort und plant, einen Konsildienst für stationäre Patienten des Klinikums zu etablieren.
Neben der Versorgungsforschung zum Informationsbedarf von Patienten zur komplementären und alternativen Medizin und zur Arzt-Patienten-Kommunikation, die gerade in der Onkologie auch zentrale medizinethische und -ökomische Aspekte berührt, liegt der wissenschaftliche Schwerpunkt von Jutta Hübner in der evidenzbasierten Untersuchung komplementärer Medizin. "Gute Studienkonzepte in der Komplementärmedizin sind sehr aufwendig, dazu sind Netzwerke notwendig und eine Forschungskultur, zu deren Etablierung ich beitragen möchte", so Jutta Hübner.
Zukunftsperspektive der integrativen OnkologieNach dem Medizinstudium in Düsseldorf absolvierte Jutta Hübner die Facharztausbildung in Innerer Medizin in Remscheid. Sie spezialisierte sich für die Hämatologie und internistische Onkologie und erwarb Zusatzqualifikationen in der Chirotherapie, Palliativmedizin, Naturheilkunde und Psychoonkologie. Nach klinischen Leitungspositionen in Bad Soden-Salmünster, Kassel und am Universitätsklinikum Frankfurt/Main arbeitete sie bei der Deutschen Krebsgesellschaft und habilitierte sich an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Stand und der Zukunftsperspektive der integrativen Onkologie.
"Die integrative Onkologie steht auf dem Boden der wissenschaftlichen, evidenzbasierten Medizin und stellt den Patienten mit seiner Perspektive und seinen Lebenszielen in den Vordergrund", betont Hübner. Mit diesem Fokus vermittelt die Professorin ihr Fach auch den Medizinstudierenden und jungen Assistenzärzten in ihrer Ambulanz. (vdG)
-
Anna Kipp
Mehr erfahrenExterner LinkAnna Kipp
Foto: FSUWenn es um ihre Forschungsergebnisse zu Zusammenhängen zwischen Ernährung und Krankheit geht, setzt Prof. Dr. Anna Patricia Kipp jedes Wort mit Bedacht. Denn die neue Professorin für Molekulare Ernährungsphysiologie der Universität Jena will zu große Hoffnungen auf eine rasche Prävention oder gar Heilung von (Darm)Krebs vermeiden. Schließlich ist das, was sie macht, vor allem Grundlagenforschung. Daher spreche sie keine Empfehlungen zu einer Selen-Zugabe in die Nahrung aus, "da noch ganz viele Erkenntnisse fehlen". Überzeugt ist die 36-Jährige allerdings schon davon, dass es einen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Selen und dem Schutz vor Darmkrebs gibt - und erforscht den Zusammenhang, um die fehlenden Erkenntnisse zu gewinnen.
Selen galt früher ausschließlich als toxische Substanz, ist aber auch ein essenzielles Spurenelement, das in der Tierernährung und als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt wird. Mit Selen kennt sich Prof. Kipp aus, hat sie doch den größten Teil ihres bisherigen Forscherlebens diesem Element, genauer den bislang rund 25 bekannten Selenoproteinen, gewidmet. "Nur von der Hälfte dieser Proteine ist bislang die genaue Funktion bekannt", weist die gebürtige Frankfurterin, die bereits früh ein Faible für Naturwissenschaften und Laborarbeit entwickelt hat, auf das bestehende Forschungsfeld hin.
Selen-Unterversorgung aktiviert Signalweg im DarmWährend ihres Studiums der Ökotrophologie an der Uni Bonn hat Anna Kipp die genregulatorische Funktion von Vitamin E untersucht. Doch bereits in ihrer Dissertation, die sie 2009 in Potsdam abschloss, untersuchte sie Signalwege im Darm, die bei einer Unterversorgung mit Selen aktiviert wurden. "Man hätte", sagt sie und betont den Konjunktiv, "aus den Ergebnissen ableiten können, dass Selen Darmkrebs verhindern kann". Doch dazu mussten weitere Untersuchungen gemacht werden. Damit beschäftigte sie sich während der Arbeiten zu ihrer Habilitation, die sie 2015 am Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam-Rehbrücke beendete. Dort untersuchte Kipp u. a. den Einfluss von Selen und unterschiedlichen Selenoproteinen an verschiedenen Darmkrebsmodellen. "Letztlich bleiben es Modelle, die ihre Grenzen haben", betont Kipp, die auch Forschungsaufenthalte in Schweden, den Niederlanden und Italien absolviert hat. Andererseits ist sie überzeugt, dass einzelne Selenoproteine bei ganz bestimmten Darmkrebsstadien hilfreich sein können - aber vereinfachend zu sagen, Selen hilft bei Darmkrebs, sei eben nicht möglich.
Dialogorientierte Lehre mit aktuellen BeispielenMit den physiologischen Funktionen und den molekularen Mechanismen von Selen will sich Prof. Kipp, die bereits nach Jena umgezogen ist, auch an der Friedrich-Schiller-Universität weiterhin beschäftigen. Sobald ihr Labor fertig eingerichtet ist, will sie zudem die Interaktion zwischen Selen und anderen Spurenelementen sowie sekundären Pflanzeninhaltsstoffen erforschen und die Jenaer Studierenden rasch an ihren neuesten Erkenntnissen teilhaben lassen. In der Lehre setze sie auf Dialogorientierung mit aktuellen Beispielen, sagt die musische Wissenschaftlerin, die als einzige Professorin mit einer Ökotrophologieausbildung am Institut für Ernährungswissenschaften sicher auch eine Vorbildfunktion haben wird. (AB)
-
Kathrin Leuze
Mehr erfahrenExterner LinkKathrin Leuze
Foto: FSU"Prepare your daughter for working life - give her less pocket money than your son". Ein Poster mit dieser plakativen Aufschrift hängt im Büro von Prof. Dr. Kathrin Leuze in der Friedrich-Schiller-Universität Jena - und spitzt zugleich eines ihrer Forschungsgebiete zu. Dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer, ist längst Gegenstand gesellschaftlicher Debatten und politischer Maßnahmen. Die neu berufene Professorin für Methoden der empirischen Sozialforschung und Sozialstrukturanalyse der Universität Jena hat darüber hinaus festgestellt, dass oft bereits die geschlechtstypische Studienfach- und Berufswahl den Grundstein für eine schlechtere Bezahlung legt.
Typische Frauenfächer weniger wertProf. Leuze interessiert sich vor allem für die großen Geschlechterungleichheiten zwischen hochqualifizierten Männern und Frauen: Während Männer häufiger Ingenieurwesen, Mathematik oder Naturwissenschaften studieren, schreiben sich mehr Frauen z. B. in Geistes- und Sozialwissenschaften ein - "und wählen damit Berufsfelder, die potenziell schlechter bezahlt werden", erklärt die Neu-Jenaerin. "Frauen sind seit jeher für Haus und Familie verantwortlich und ergreifen bis heute oft Berufe, die aus dem Privaten kommen und mit Fürsorge, Pflege oder Erziehung zusammenhängen. Noch immer sind diese Jobs gesellschaftlich weniger wert und zudem gewerkschaftlich schlechter organisiert als typische Männerdomänen", so die 41-Jährige.
Arbeitsmarkterträge von Akademikerinnen und Akademikern beschäftigen Leuze schon lange. Zum Beispiel sind ihr im Rahmen ihrer Dissertation an der Universität Bremen, in der sie den Berufsstart in Deutschland und Großbritannien miteinander verglich, enorme Länderunterschiede aufgefallen. "Der Arbeitsmarkteinstieg von Hochschulabsolventinnen und -absolventen ist hierzulande wesentlich leichter aufgrund der klaren Strukturiertheit des Arbeitsmarkts, was z. B. typische Ausbildungs- und Akademikerberufe angeht, und die vergleichsweise geringe Zahl an Studierten", benennt sie ein Ergebnis. Dass Frauen der Einstieg in beiden Ländern nichtsdestotrotz schwerer fällt, zeigt die Studie ebenfalls auf.
Abkehr von Rollenvorbildern ist soziologisch spannendIhrer Promotion, inklusive Forschungsaufenthalt an der britischen University of Stirling, folgte die Mitarbeit am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung in einem Projekt zur Untersuchung der Geldverwaltung und -verteilung in Partnerschaften. Anschließend lehrte die Bildungssoziologin, die gebürtig aus dem bayrischen Mühldorf am Inn stammt, an der Freien Universität Berlin und der Universität Hannover.
An der Friedrich-Schiller-Universität angekommen, will sie künftig vor allem weiter zu Ursachen und Auswirkungen von innerpartnerschaftlichen Ungleichheiten forschen. "Normativ gesehen müssten beide Partner die gleichen Rechte und Pflichten haben. Aber sogar wenn beide berufstätig sind, arbeiten die Männer in der Regel mehr und Frauen kümmern sich zum großen Teil um das Private, den Haushalt, Kinder - selbst wenn sie mehr verdienen als ihre Partner." Kathrin Leuze, selbst verheiratet und Mutter zweier kleiner Kinder, möchte insbesondere die Bedingungen einer gelungenen ausgeglichenen Verteilung von Erwerbs-, Haushalts- und Fürsorgearbeit in Partnerschaften genauer untersuchen.
Interessant sei zudem, dass Töchter beruflich oft ihren Müttern nacheifern, während Jungen in eine ähnliche Richtung wie die Väter gehen. Auch hier wird sich Leuze den Beweggründen der soziologisch spannenden Ausnahme von der Regel widmen: den Mädchen, die eben doch ausbrechen und entgegen der Norm Naturwissenschaften oder Technik studieren.
In der Lehre ist ihr vor allem wichtig, schon früh inhaltliche Anwendungsbezüge bei der empirischen Methodenausbildung herzustellen. "Sonst fragen sich Soziologiestudierende schnell, warum sie das eigentlich machen", weiß sie aus eigener Erfahrung. Die Verbindung des methodischen Handwerkszeugs mit soziologisch relevanten Themen würde dagegen schnell verdeutlichen, um welch spannendes Forschungsfeld es sich handelt: "Im Grunde kann aus allem eine soziologische Fragestellung werden", sagt Prof. Leuze. Daher sei es zentral, dass die Studierenden ein Gefühl für die Soziologie bekommen und lernen, eigene Forschungsfragen zu entwickeln. (jd)
-
Sophie Marshall
Mehr erfahrenExterner LinkDenomination: Germanistische Mediävistik
zuvor: Universität Stuttgart
-
Michaela Riediger
Mehr erfahrenExterner LinkMichaela Riediger
Foto: FSUViele Eltern hoffen, dass mit dem Ende der Pubertät die Entwicklung ihrer Sprösslinge abgeschlossen ist - und sie hoffen natürlich auf ein ruhigeres Leben. Die Pubertät ist eine Phase großer Veränderungen, aber die "Entwicklung hört nicht mit Erreichen des Erwachsenenalters auf, sondern umfasst den gesamten Lebenslauf von der Konzeption bis zum Tod", betont Prof. Dr. Michaela Riediger von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die neu berufene Professorin für Entwicklungspsychologie vertritt diese Lebensspannenperspektive in Lehre und Forschung und so untersucht sie in ihren Studien sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene unterschiedlicher Altersgruppen. Auch die Frage, wie sich Prozesse der sogenannten Selbstregulation entwickeln - also zum Beispiel kontrollieren zu können, wann man welche Emotionen wie erlebt und ausdrückt - gehört zu Riedigers zentralen Forschungsthemen.
Altern ist mehr als VerlustEines ihrer Forschungsergebnisse zeigt beispielsweise, dass die landläufige Vorstellung, Alter und Altern sei vorrangig von Abbau und Verlust gekennzeichnet, zu vereinfachend ist. Viele ältere Menschen berichten etwa von einem durchschnittlich besseren Wohlbefinden im Alltag als dies jüngere Personen tun. Eine Abnahme im Wohlbefinden tritt bei vielen älteren Personen oft erst kurz vor dem Lebensende ein.
Die gebürtige Berlinerin hat sich bereits im Studium an der Humboldt-Universität für die Entwicklungspsychologie interessiert. Für ihre Dissertation am Berliner Max-Planck-Institut (MPI) für Bildungsforschung und der Freien Universität Berlin untersuchte sie, wie gut Erwachsene in verschiedenem Alter geplante Lebensstiländerungen - hier regelmäßige sportliche Betätigung - langfristig tatsächlich umsetzen können, und welche Rolle die sonstigen Lebensziele der Personen in diesem Zusammenhang spielten. "Ältere Menschen berichteten durchschnittlich weniger über Zielkonflikte als jüngere Menschen. Gleichzeitig sahen sie die geplante Lebensstiländerung eher als hilfreich für ihre anderen Ziele an. Dies trug dazu bei, dass ältere Teilnehmer längerfristig auch erfolgreicher ihren Lebensstil änderten und insgesamt zufriedener waren", fasst die Psychologin die Ergebnisse zusammen. Habilitiert hat sich Michaela Riediger an der Universität Zürich und war danach als Leiterin der Forschungsgruppe "Affekt im Lebensverlauf" am MPI für Bildungsforschung tätig. Als Heisenberg-Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft leitete sie später das Kooperationsprojekt "Sozioemotionale Entwicklung und Gesundheit im Lebensverlauf".
"In unserer Forschung ist es uns besonders wichtig, längsschnittliche Studien durchzuführen, um Entwicklungsprozesse abbilden zu können, und Phänomene zu untersuchen, die im Lebensalltag relevant sind", erklärt Riediger. "Dazu wenden wir unter anderem Methoden an, die es erlauben, Erleben und Verhalten von Studienteilnehmern im Moment ihres Auftretens in den natürlichen Lebenskontexten zu messen." Ein Beispiel ist die Methode des sogenannten "Experience Sampling". Hierzu nutzt Riedigers Arbeitsgruppe unter anderem Handys als Erhebungsinstrumente: "Die Teilnehmer tragen die Telefone mit sich, während sie ihrem normalen Alltag nachgehen. Ab und zu werden darüber Fragen zu momentanen Erfahrungen und Verhaltensweisen gesandt oder Aufgaben, die zu bearbeiten sind." So konnte beispielsweise herausgefunden werden, dass die durchschnittliche altersbezogene Abnahme in der Gedächtnisleistung, die in typischen Laborsituationen häufig stark ausgeprägt ist, deutlich geringer ausfällt, wenn die Messung in natürlichen Lebenskontexten erfolgt.
Sehr gute entwicklungspsychologische Anknüpfungspunkte in Jena
In der Lehre möchte Prof. Riediger eine ausgewogene Mischung an Theorie, Empirie und praktischem Anwendungsbezug vermitteln. Dass sich ihre Studierenden aktiv und selbstständig mit den Inhalten auseinandersetzen, ist ihr ebenso wichtig, wie den aktuellsten Stand der internationalen Forschung zu unterrichten. Vor allem Feedback-Prozesse mit und unter den Studierenden sowie Teamarbeit möchte sie in ihren Seminaren etablieren.
Dem Ruf der Universität Jena ist Prof. Riediger vor allem deshalb gern gefolgt, weil sie hier sehr gute Anknüpfungspunkte für ihre Forschung vorfindet. "Gerade im Bereich Alter und Altern ist Jena sehr gut aufgestellt", findet die zweifache Mutter. "Hier kann ich mich inhaltlich und methodisch entfalten und meine Forschungsinteressen weiter verfolgen." (jd/AB)
-
Thorsten Schäfer
Thorsten Schäfer
Foto: FSUWinzige Teilchen und extrem lange Zeiträume faszinieren Prof. Dr. Thorsten Schäfer gleichermaßen. Beide begleiten den neuen Lehrstuhlinhaber für Angewandte Geologie an der Universität Jena auf seinem Berufsweg.
Thorsten Schäfer wurde 1998 über den Schadstofftransport an Kolloiden im Trinkwasser promoviert und die Nanopartikel haben ihn seitdem nicht wieder losgelassen. Seine Forschungsergebnisse fließen zudem in die Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle ein. Das Endlager soll den problematischen Abfall für eine Million Jahre von der Biosphäre isolieren.
Umweltverträglichere Abbauverfahren für Rohstoffe
"Es gibt erstaunliche Wechselwirkungen an den Grenzflächen zwischen Mineralien und Wasser oder zwischen Wasser und lebenden Organismen", sagt Thorsten Schäfer. Dort entstehen dynamische Systeme, deren Eigenschaften noch längst nicht vollständig erforscht sind. "Für maximale Sicherheit eines Endlagers müssen wir möglichst viele Prozesse verstanden haben, die dort ablaufen", sagt Thorsten Schäfer. Der 47-jährige gebürtige Wiesbadener sieht in diesem Feld noch jede Menge Forschungsbedarf. So sei es bei einem Endlager in Tonstein oder Kristallin nicht zu verhindern, dass früher oder später Wasser mit dem radioaktiven Abfall in Berührung kommt. Für diesen Fall werden die Barrierematerialien reagieren und dabei unter anderem auch neue Mineralphasen entstehen, die eine zusätzliche Rückhaltung der radioaktiven Stoffe bewirken können. Ein weiteres Forschungsziel sind umweltverträglichere Abbauverfahren für Rohstoffe. Um das zu erreichen, müsse beispielsweise geklärt werden, wie die Lagerstätten einst entstanden sind.
Thorsten Schäfer hat in Mainz Geologie studiert, mit den Schwerpunkten Hydrogeologie und Geochemie. Nach seiner Promotion in Mainz wechselte er nach Karlsruhe ins Forschungszentrum "Technik und Umwelt". Im Jahr 2000/01 hatte Schäfer die Chance, in die USA zu gehen. Er arbeitete für das Department of Energy am Brookhaven National Laboratory auf Long Island bei New York. Sein Tätigkeitsfeld war an der Synchrotron-Strahlenquelle NSLS zu Schadstoffmessungen mit einem Röntgenmikroskop mit einer Ortsauflösung im Nanometerbereich. "Die Gruppe von Janos Kirz und Chris Jacobsen in den USA war weltweit führend", konstatiert Thorsten Schäfer. Seine Messungen damals seien Neuland gewesen, inzwischen gehören die angewandten Verfahren zum Standard für Umweltproben. Nach dem USA-Aufenthalt führte Schäfers Weg wieder nach Karlsruhe. Am Institut für Nukleare Entsorgung (INE) des neu entstandenen Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) übernahm er zunächst die Gruppe zur Radionuklidmigration inklusive der Forschungsaktivitäten in Untertagelaboren, später die komplette Abteilung Geochemie. Im Jahr 2008 folgte die Habilitation an der Freien Universität Berlin, das Thema waren Grenzflächenprozesse und Nanopartikel in der Natur. Seit 2014 hatte Thorsten Schäfer eine Professur für Umweltgeologie inne.
Generationenübergreifend das ideale Endlager suchenLehrverpflichtungen nimmt Schäfer, der verheiratet ist und drei Kinder hat, gern wahr: "Es macht immer wieder Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten." Zudem gebe es in der Geologie Themen, an denen generationenübergreifend gearbeitet werden muss. Die Endlager-Suche sei ja das beste Beispiel dafür: "Die Probleme, an denen wir arbeiten, haben wir nicht selbst verursacht und werden wir allein auch nicht lösen."
An seiner neuen Stelle am Institut für Geowissenschaften habe ihn vor allem gereizt, auf renommierte Wissenschaftler zu treffen, von denen er einige bereits gut kennt. Außerdem sei Jena instrumentell sehr gut ausgestattet, sagt Thorsten Schäfer. Ob er allerdings in der Saalestadt viel Zeit für sein Hobby findet, das sei nicht gewiss: Schäfer ist passionierter Rennradfahrer und war schon öfter für Tage in den Alpen unterwegs: "Auf dem Rennrad bekommt man so herrlich den Kopf frei!" (sl)
-
Heidemarie Schmidt
Mehr erfahrenExterner LinkHeidemarie Schmidt
Foto: FSUHeidemarie Schmidt, die seit dem 1. September 2017 Professorin für Festkörperphysik mit dem Schwerpunkt Quantendetektion am Institut für Festkörperphysik (IFK) der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist, übernimmt die Leitung der Abteilung Quantendetektion am Leibniz-Institut für Photonische Technologien Jena (Leibniz-IPHT). Damit tritt sie die Nachfolge des bisherigen Abteilungsleiters Prof. Hans-Georg Meyer an. Die Forschungsgebiete der Physikerin umfassen Quantentechnologie, Biotechnologie und neue Materialsysteme für die Nanoelektronik.
Die Universität Jena und das Leibniz-IPHT beriefen Heidemarie Schmidt gemäß dem "Berliner Modell" gemeinsam zur Professorin und Abteilungsleiterin. An der Universität forscht die Wissenschaftlerin, die bisher eine Arbeitsgruppe an der Technischen Universität Chemnitz leitete, an neuen magnetisierbaren und elektrisch polarisierbaren Materialien für kleinste elektronische Bauelemente, die zukünftig die klassische Halbleiterelektronik ablösen könnten. Am Leibniz-IPHT gibt sie mit ihrer Arbeit am Querschnitt von optischer Spektroskopie, Biologie und Quantentechnologie neue Forschungsimpulse für die lichtbasierten Gesundheitstechnologien sowie für hochempfindliche Sensoren und Detektoren.
Forschungsthemen am Leibniz-IPHT
In der Abteilung Quantendetektion untersucht Heidemarie Schmidt, auf wenige Nanometer genau, die Verschiebung elektrischer Ladungen in Biomaterialien wie Zellen, Gewebe oder Proteinen, indem sie die Materialien mit Licht einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt. Aus dieser Ladungsverschiebung kann sie Aussagen über die biochemischen Eigenschaften der biologischen Spezies ableiten. Die Messungen dienen der Aufklärung grundlegender biologischer Fragestellungen und ermöglichen Rückschlüsse auf mögliche krankhafte Veränderungen beispielsweise von Zellen oder Gewebe.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt der Physikerin sind mikro- und nanostrukturierte Bauelemente für hochempfindliche Sensoren und Detektoren, die bereits seit 30 Jahren in der Abteilung Quantendetektion am Leibniz-IPHT erforscht und entwickelt werden. Sie messen berührungslos körpereigene Wärmestrahlung, kleinste Änderungen des Magnetfelds oder die Temperatur auf der Oberfläche von Kometen. Heidemarie Schmidt plant die erfolgreichen Forschungsarbeiten fortzusetzen und neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung an supraleitenden Festkörper-Quantenmaterialien in praxisnahe Anwendungen wie die Quanteninformatik zu überführen. In Quantencomputern soll die Technologie zukünftig unter eine leistungsfähigere Leitung, Verarbeitung und Speicherung von Informationssignalen ermöglichen.
Forschungsthemen an der Friedrich-Schiller-Universität
Als Professorin für Festköperphysik mit dem Schwerpunkt Quantendetektion am IFK möchte Heidemarie Schmidt optische Polarisationsmessungen zur Untersuchung neuer magnetisierbarer und elektrisch polarisierbarer Festkörper-Mehrschichtsysteme etablieren. Sie bilden die Grundlage für Sensoren, die mit nanometergenauer Ortsauflösung Änderungen des Magnetfeldes und des elektrischen Feldes nachweisen können.
Das Forschungsgebiet von Heidemarie Schmidt umfasst zudem Materialien, die sich als Träger für die Charakterisierung einzelner Biomoleküle mittels hochaufgelöster spektroskopischer Methoden eignen. Dafür erzeugen die Forscherinnen und Forscher Siliziumträger mit einem vorgegebenen Ladungsmuster, an dem sich, dank der oberflächennahen, elektrostatischen Kräfte, die biologischen Proben ausrichten können. In enger Zusammenarbeit mit dem Leibniz-IPHT möchte Heidemarie Schmidt biologische Spezies an die Träger binden und sie mittels ihrer optischen Polarisation auf mögliche biochemische Veränderungen untersuchen.
In Jena schätzt Heidemarie Schmidt die vielfältigen Forschungsmöglichkeiten, die erstklassige Infrastruktur des Leibniz-IPHT im Bereich Mikro- und Nanotechnologie sowie die intensive Zusammenarbeit zwischen Universität, Forschungsinstituten und hier ansässigen Industriepartnern. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Leibniz-IPHT besitzen exzellentes wissenschaftliches Know-How auf dem Gebiet der Quantentechnologie und Biophotonik. Mit meinen Arbeiten kann ich auf diesen langjährigen Erfahrungsschatz aufbauen sowie neue Forschungsfelder erschließen und aktiv mitgestalten. Die Ergebnisse möchten wir in anwendungsnahe Systeme und Verfahren umsetzen," fasst Schmidt zusammen. In ihrer Position als Professorin und Abteilungsleiterin freut sie sich besonders auf die Ausbildung der Studierenden und die Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zur Person
Heidemarie Schmidt studierte Physik an der Universität Leipzig, wo sie 1999 ihre Promotion über Bandstrukturen in ultradünnen Schichten von Halbleitern abschloss. Am Institut für Experimentelle Physik II der Universität Leipzig leitete sie im Zeitraum von 2003 bis 2007 die BMBF-Nachwuchsgruppe "Nano-Spintronik". Ab 2007 übernahm sie eine gleichnamige Nachwuchsgruppe am Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Schmidt erhielt im Jahr 2012 ein Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem sie die Leitung der Arbeitsgruppe "Nano-Spintronik" an der Technischen Universität Chemnitz (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik) antrat. Mit dem ATTRACT-Preis der Fraunhofer-Gesellschaft baute sie 2016 die Arbeitsgruppe "BFO4ICT" am Fraunhofer-Institut ENAS in Chemnitz auf. Ihre Forschungsinteressen reichen von magnetischen Oxiden und Multiferroika über Memristoren bis hin zu Trägern für elektrisch polarisierbare Nano- und Mikromaterialien. Zu den von Heidemarie Schmidt untersuchten Materialien zählen Halbleiternanostrukturen, magnetische Halbleiter sowie Oxidnanostrukturen. (AS)
-
Birgitta Schultze-Bernhardt
Mehr erfahrenExterner LinkProf. Dr. Birgitta Bernhardt
Foto: FSUViele chemische Prozesse sind so schnell, dass nur ihr ungefährer Ablauf bekannt ist. Zur Aufklärung dieser Prozesse hat nun ein Team an der Technischen Universität München (TUM) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) eine Methode mit einer Auflösung von Trillionstel-Sekunden entwickelt. Die neue Technik soll helfen, Prozesse wie die Photosynthese besser zu verstehen oder schnellere Computerchips zu entwickeln,
Ein wichtiger Teilschritt vieler chemischer Prozesse sind Ionisierungen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Photosynthese. Diese Reaktionen laufen extrem schnell ab. Sie dauern nur wenige Femto-, also Billiardstel-Sekunden oder sogar nur einige hundert Attosekunden (Trillionstel-Sekunden). Aufgrund dieser kurzen Zeitskala sind zwar Anfangs- und Endprodukte der Reaktionen bekannt, nicht jedoch die Reaktionswege und Zwischenprodukte.
Um solche ultraschnellen Prozesse verfolgen zu können, braucht die Wissenschaft daher eine Messtechnik, die noch schneller ist als der beobachtete Prozess selbst. Dies ist mit der sogenannten "Pump-Probe-Spektroskopie" möglich.
Dabei wird die Probe von einem ersten Laserpuls angeregt und die Reaktion in Gang gesetzt. Ein zweiter, zeitversetzter Puls fragt dann den Zustand des Prozesses ab. Durch Wiederholungen der Reaktion mit unterschiedlichen Zeitverzögerungen ergeben sich viele einzelne Momentaufnahmen, die dann zu einem "Video" zusammengesetzt werden.
Mehr sehen mit dem ZweitenNun ist es Wissenschaftlern um Birgitta Bernhardt, ehemals Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Laser- und Röntgenphysik der TU München und inzwischen Junior-Professorin an der Universität Jena, am Beispiel des Edelgases Krypton erstmals gelungen, zwei verschiedene Pump-Probe-Spektroskopietechniken zu kombinieren und so die ultraschnellen Ionisierungsprozesse in zuvor nicht möglicher Genauigkeit sichtbar zu machen.
"Vor unserem Experiment konnte man entweder betrachten, welcher Anteil des anregenden Lichtes über die Zeit von der Probe absorbiert wird, oder messen, welche und wie viele Ionentypen dabei entstehen", erklärt Bernhardt. "Wir haben nun beide Techniken vereint und können auf diese Weise sehen, über welche genauen Schritte die Ionisierung abläuft, wie lange diese Zwischenprodukte bestehen bleiben und was genau der anregende Laserpuls in der Probe tut."
Kontrolle ultraschneller ProzesseMit der Kombination der beiden Messtechniken können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur ultraschnelle Ionisierungsprozesse aufzeichnen. Durch die Variation der Intensität des zweiten, abfragenden Laserpulses können sie erstmals auch die Ionisierungsdynamik gezielt kontrollieren und auf diese Weise beeinflussen.
"Diese Kontrolle ist ein sehr starkes Instrument", erklärt Bernhardt. "Wenn wir schnelle Ionisierungsprozesse genau nachvollziehen und sogar beeinflussen können, lernen wir viel Neues über lichtgesteuerte Prozesse wie die Photosynthese - gerade über jene ersten Momente, die diese komplexe Maschinerie in Gang setzen und die bislang kaum verstanden sind."
Ultraschnelle ComputerAuch für die Entwicklung neuer, schnellerer Computerchips, in denen die Ionisierung von Silizium eine wesentliche Rolle spielt, ist die von Bernhardt und ihren Kollegen entwickelte Technik interessant. Kann man Ionisierungszustände von Silizium innerhalb eines so kurzen Zeitfensters nicht nur abfragen, sondern auch kontrolliert setzen - wie es die ersten Experimente am Krypton nahelegen - könnten Wissenschaftler dies vielleicht einmal nutzen, um neuartige und noch schnellere Computertechnologien zu entwickeln.
-
Isabell Staude
Mehr erfahrenExterner LinkProf. Dr. Staude
Foto: FSUDenomination: Funktionelle Photonische Nanostrukturen
zuvor: Universität Jena
-
Christoph Steinbeck
Mehr erfahrenExterner LinkChristoph Steinbeck
Foto: FSUVon Supercomputern träumen viele Wissenschaftler. Doch die Großgeräte sind wartungs- und bedienungsaufwendig und v. a. teuer. Prof. Dr. Christoph Steinbeck von der Friedrich-Schiller-Universität Jena löst daher seinen immensen Rechenbedarf, indem er nur für die benötigte Zeit Rechenkapazität bei kommerziellen Anbietern einkauft: in deren Clouds - also in rechnerunabhängigen IT-Umgebungen. "Man kauft sich relativ billig Rechenleistung ein", erklärt der neue Professor für Analytische Chemie - Chemometrik/Chemoinformatik, und kann dort große Datenmengen auch im Verbund bearbeiten. Dass es geht, beweist er gerade im Rahmen eines EU-Projekts mit 14 Partnern, bei dem Cloud-Computing für die Untersuchung großer medizinischer Datenmengen eingesetzt wird. Dort werden Plattform-unabhängige Arbeitsabläufe und "Toolkits" entwickelt, "die auch hinter Firewalls funktionieren", also dem Datenschutz gerecht werden, erläutert Projekt-Sprecher Steinbeck.
Strukturaufklärung von Naturstoffen
Der 1966 in Neuwied geborene Christoph Steinbeck, der sich das Programmieren schon als Schüler autodidaktisch beigebracht hat, studierte Chemie in Bonn. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit der Fragestellung, wie man aus spektroskopischen Daten von Naturstoffen bzw. deren Derivaten möglichst effizient die Struktur des Stoffes ermitteln kann. Für diese kombinatorischen Puzzles setzte der Chemiker auf den Computer und es gelang ihm dabei, die Suchräume einzuschränken. Eine Identifizierung des Naturstoffs wurde einfacher.
Schon diese Forschungen, die er danach an der Tufts University in den USA vertiefte, führten Steinbeck von der analytischen Chemie Richtung Bio-Chemie und -Informatik. So kam er 1997 als Leiter einer Arbeitsgruppe an das Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena und habilitierte sich in Organischer Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität zur Algorithmenentwicklung in der Bioinformatik. Dies baute er als Leiter einer Arbeitsgruppe zur Molekular-Informatik in Köln weiter aus, bevor er 2008 nach England wechselte. Am European Bioinformatics Institute (EBI) in Hinxton bei Cambridge, einer Außenstelle des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg, entwickelte er chemische Datenbanken für die Lebenswissenschaften. Er sei "Anhänger von Open Source Software und frei verfügbaren Daten", betont Prof. Steinbeck. Und inzwischen sei ihm eine "breite Verwendung der Ergebnisse" sehr wichtig.
Stiftungsprofessur der Carl-Zeiss-Stiftung
Diese Anwendungsorientierung, seine interdisziplinäre Ausrichtung und sein Wunsch, "Professor an einer traditionsreichen Universität zu werden", ließen ihn den Ruf auf die "Stiftungsprofessur der Carl-Zeiss-Stiftung", die die Stiftung in den nächsten fünf Jahren mit über 1,2 Mio. Euro fördert, an der Jenaer Voll-Universität annehmen. Hier könne er endlich wieder auch lehren und die Grundlagen des eigenen Fachs wiedergeben, freut sich der musisch begabte Wissenschaftler. Die Studierenden will er motivieren, "über den Tellerrand des Fachs hinauszublicken".
Das macht auch Christoph Steinbeck nicht nur bei seiner interdisziplinären Forschung. Privat schätzt es der verheiratete Neu-Jenaer, der auf Yoga und Meditation zum Ausgleich des stressigen Arbeitstages setzt, handwerklich zu arbeiten und so hat er sich bereits eine kleine Holzwerkstatt eingerichtet - auch als Kontrapunkt zu seiner Arbeit am Rechner. (AB)
-
Claudia Waskow
Mehr erfahrenExterner LinkDer Erhalt von Stammzellen ist insbesondere in Geweben, die sich häufig und schnell regenerieren müssen, von essenzieller Bedeutung für die Organfunktion in Gesundheit und Krankheit. Blutstammzellen haben hier eine doppelte Funktion. Denn sie sind nicht nur für die ständige Bluterneuerung, sondern auch für die Bildung unseres Immunsystems zuständig. Häufen sie im Alter Schäden an und verlieren sie ihre Funktionalität, so ist die Immunantwort des Körpers gestört, was die Entstehung typischer Alterskrankheiten und eine generelle Anfälligkeit für Infektionen im Alter bedingt. Auf diesem Forschungsgebiet - zwischen Stammzellforschung und Immunologie - ist Prof. Waskow eine international anerkannte Expertin. Sie studierte in Mainz und Glasgow Biologie mit den Schwerpunkten Immunologie, Biochemie, Genetik und Zoologie und wurde 2002 an der Universität Basel promoviert. Ihre Forschungsstationen führten sie danach von Ulm über New York bis nach Dresden, wo sie 2008 zunächst die Leitung der Gruppe "Regeneration in der Hämatopoese" am DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien der TU Dresden (CRTD) und ab 2014 eine Professur für Immunologie übernahm. Neben der Leitung der Forschungsgruppe "Regeneration in der Hämatopoese und Immunologie des Alterns" am FLI wird Waskow im Rahmen des ProExzellenz-Projekts "RegenerAging" eine Professur für Immunologie des Alterns an der FSU übernehmen. (PM)
-
Andrea Wittig
Andrea Wittig
Foto: J. LaackmannDie Behandlung von Patienten vom Säugling bis zum Greis, mit gut- und bösartigen Erkrankungen vom Hirn bis zur Ferse, in Zusammenarbeit mit fast allen anderen medizinischen Fachrichtungen und im Team mit Naturwissenschaftlern, medizinisch-technischen Assistenten und Pflegespezialisten - Andrea Wittig fallen sofort viele Gründe ein, warum sie sich für die Strahlentherapie entschieden hat. Die 46-jährige Medizinerin ist seit 1. Juli Professorin für Strahlentherapie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Direktorin der Klink für Strahlentherapie und Radioonkologie des Universitätsklinikums Jena (UKJ). Die Behandlung mit ionisierender Strahlung ist eine der Säulen in der Krebstherapie, entsprechend ist ein Großteil der Patienten der Klinik wegen Tumoren oder Metastasen in Behandlung. Aber auch gutartige entzündliche Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Fersensporn, werden bestrahlt.
"Die Präzision und die Spezifität der Therapie werden ständig weiterentwickelt, mit dem Ziel einer effektiven Behandlung der Zielstrukturen und der bestmöglichen Schonung der umliegenden Gewebe und Organe", so Prof. Wittig. Die Strahlenmedizinerin und die Wissenschaftler in ihrer Klinik beteiligen sich sowohl mit strahlenbiologischen Fragestellungen als auch mit methodisch-technischen Projekten an dieser Entwicklung. Als Beispiel nennt Wittig Karzinome im Rachenraum: "Deren Tumorbiologie unterscheidet sich je nachdem, ob sie durch Gifte wie Tabak und Alkohol oder durch eine Virusinfektion verursacht werden. Das führt zu einem unterschiedlichen Ansprechen der Radiochemotherapie, die entsprechend individuell angepasst werden sollte."
Kombination von Bestrahlungszyklen und Immuntherapien testen
Die Wissenschaftler arbeiten auch an Algorithmen, die in unmittelbarer Kombination mit bildgebenden Verfahren die Anpassung der Strahlung in Intensität und Bestrahlungsgebiet ermöglichen. So können zum Beispiel Atembewegungen berücksichtigt werden oder die schon erreichte Verkleinerung des Tumors durch Strahlentherapie in deren Verlauf, die sog. adaptive Strahlentherapie. "In der klinischen Forschung entwickeln und überprüfen wir Hochpräzisionstechniken und beteiligen wir uns u. a. an Studien, die die Kombination von Bestrahlungszyklen mit den in den vergangenen Jahren entwickelten Immuntherapien testen", so Prof. Wittig.
Andrea Wittig studierte Humanmedizin an der Universität Essen, wo sie auch promoviert wurde und sich zu einer speziellen Form der Partikelstrahlentherapie habilitierte. Nach der Anerkennung als Fachärztin für Strahlentherapie in Deutschland und in den Niederlanden arbeitete sie als Oberärztin am Universitätsklinikum Essen und wechselte danach an die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie in Marburg/Gießen, wo sie zur Professorin für Radioonkologie an der Philipps-Universität in Marburg berufen wurde und zuletzt die Standortleitung in Gießen innehatte.
Grundlagenforschung und Klinik verbinden
In ihrer bisherigen Karriere ist es Prof. Wittig immer gelungen, Grundlagenforschung und Klinik zu verbinden und dabei in internationalen Forschungsverbünden zu arbeiten. Noch während des Studiums arbeitete sie in einem eigenen wissenschaftlichen Projekt für ein Semester in den USA am Brookhaven National Laboratory, später war sie im Rahmen von Forschungsprojekten u. a. der Europäischen Union tätig.
Das Ankommen am Jenaer Klinikum wird schnell gehen, ist sich Prof. Wittig sicher, ist die Strahlentherapie doch ein zentraler Partner im Universitätstumorzentrum und die Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken sehr eng, auch wenn die Strahlenklinik noch in der Bachstraße beheimatet ist. Sie wird in den Neubauabschnitt in Lobeda einziehen, der am Ort der ehemaligen Klinik für Innere Medizin errichtet werden wird. Andrea Wittig: "Die Klinik für den Umzug neu zu strukturieren und die Räumlichkeiten und die technische Ausstattung in Lobeda mitzugestalten, ist eine große aber sehr reizvolle Aufgabe."
Ebenso reizvoll ist es für die neue Professorin, ihr Fach den Studierenden nahezubringen. "Die Strahlentherapie ist im Studium unterrepräsentiert, sichtbar wird sie eigentlich erst im Praktischen Jahr." Deshalb freut sich Wittig, dass ihre Klinik als eine der ersten das PJplus-Programm des Uniklinikums etabliert hat und die Studierenden im letzten Studienjahr in einer gut strukturierten Ausbildung die Vielfalt der Strahlentherapie kennenlernen können. (vdG)
-
Maik Wolters
Maik Wolters
Foto: Jürgen ScheereDer deutschen Wirtschaft geht es derzeit sehr gut - davon ist Prof. Dr. Maik Wolters von der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) überzeugt. "Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Weltwirtschaft befindet sich im Aufschwung und davon profitieren wir auch hierzulande", erklärt der neu berufene Professor für Makroökonomik. Der Aufschwung sei bisher vor allem durch den Privatkonsum getrieben, denn aufgrund der guten Beschäftigungslage, des gesunkenen Ölpreises und eines niedrigen Zinsniveaus bleibe Geld übrig, das für Konsumgüter ausgegeben werde.
"Die Eurokrise, speziell der Brexit und das kriselnde Italien, oder die amerikanische Politik unter Donald Trump bedeuten natürlich Risiken, durch die sich die aktuell gute Lage schnell ändern könnte", weiß der Wirtschaftswissenschaftler insbesondere durch seine Tätigkeit als Research Fellow am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, die er auch künftig fortsetzen wird. Zusammen mit Experten der führenden Wirtschaftsinstitute arbeitet er zweimal jährlich an der Gemeinschaftsdiagnose zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung für die Bundesregierung.
Walter Eucken auf der SpurUrsprünglich an der Universität Bielefeld mit BWL gestartet, habe Wolters in den Makroökonomik-Vorlesungen schnell gemerkt, dass sein Herz für die Volkswirtschaftslehre schlage. Einen ersten Abschluss machte der gebürtige Hannoveraner im Anschluss an ein Auslandssemester an der Business School in Rennes, Frankreich, bevor er für ein Masterstudium an die Universität Frankfurt ging. Praktika im hiesigen Bankensektor fand er zwar spannend, doch mehr noch faszinierte den heute 34-Jährigen die Auseinandersetzung mit Forschungsfragen und makroökonomischen Modellen. Deshalb schlossen sich die Promotion über Konjunkturmodelle und Geldpolitik sowie die Post-Doc-Phase in Frankfurt, inklusive Forschungsaufenthalt an der amerikanischen Elite-Uni Stanford, nahtlos an. In den vergangenen fünf Jahren lehrte er an der Universität Kiel als Juniorprofessor für Makroökonomik. Besonders Finanzkrisen haben es dem Wirtschaftswissenschaftler angetan: "Krisen sind schlecht für die Welt, aber für die Volkswirtschaftslehre sehr interessant, da sie zum Überdenken des aktuellen Forschungsstandes anregen."
Dem Ruf der FSU ist Maik Wolters gern gefolgt - nicht nur weil er nach der Goethe-Universität in Frankfurt nun an der nach dessen Freund Schiller benannten Uni tätig ist. "Der große inhaltliche Gestaltungsspielraum und die Verbindungen zu vielen nationalen sowie internationalen Partnern passen perfekt zu meiner Forschung", findet Wolters. Es fügt sich außerdem gut ein, dass er hier auf den Spuren Walter Euckens wandelt, Begründer des Ordoliberalismus und Vordenker der sozialen Marktwirtschaft. Wie dieser hält auch Wolters es für unerlässlich, dass der Staat der Wirtschaft einen klaren Ordnungsrahmen vorgibt - "zu viele Eingriffe ins Marktsystem sind jedoch problematisch, weil sie die freie Entfaltung innerhalb dieses Rahmens behindern", erläutert Prof. Wolters.
Ökonomische Intuition entwickelnIn der Lehre ist es ihm wichtig, seine Begeisterung für die Makroökonomik an die Studierenden weiterzugeben. Dabei sollen sie zum einen methodische und statistische Kenntnisse erlernen, andererseits aber auch ökonomische Intuition entwickeln. Somit erhalten sie das Rüstzeug, um volkswirtschaftliche Modelle auf aktuelle Ereignisse anzuwenden und Lösungen für wirtschaftspolitische Fragen zu entwickeln. Denn nicht auf den bloßen Konsum von Fakten komme es an, sondern darauf, eigenständige Analysen durchführen zu können.
Bereits im Februar ist der junge Wissenschaftler mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn von der Ostsee in die Saalestadt gezogen. Sein Großvater stammt aus Jena und wurde hier an der Uni im Fach Chemie promoviert, Maik Wolters dagegen lernt Jena erst kennen: "Die bergige Landschaft ist toll und die Nähe zum Thüringer Wald ist großartig. Uns gefällt es hier wirklich gut." (jd)
-
Roland Zech
Mehr erfahrenExterner LinkRoland Zech
Foto: FSUMit gewohnt großer Inszenierung verkündete US-Präsident Donald Trump Anfang Juni, dass die Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimavertrag aussteigen werden. Ihren Verpflichtungen, die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase zu drosseln, wollen die Vereinigten Staaten nicht nachkommen, weil - so Trump - hohe Kosten für die amerikanische Wirtschaft damit verbunden seien. Stattdessen wolle er weiter auf fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle setzen.
"Einen Schritt zurück in die Vergangenheit", nennt das Prof. Dr. Roland Zech von der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU). "Aber ein Zurück in die Zeit, in der Industriestaaten ungebremst Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen, wird es dennoch nicht geben", ist sich der Geograph sicher, der in diesem Sommersemester den Lehrstuhl für Physische Geographie der Jenaer Uni übernommen hat. Denn ein Gutes habe die Ankündigung Trumps bewirkt: Die Weltgemeinschaft habe in seltener Einhelligkeit darauf reagiert und halte an ihren Klimazielen fest, die durch Treibhausgase verursachte Erderwärmung auf maximal 1,5 °C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken.
In den Archiven des Weltklimas lesen
Der Klimawandel ist eines der zentralen Forschungsthemen von Prof. Zech. Der 40-Jährige, der von der Universität Bern an die FSU wechselte, hat dabei allerdings weitaus größere Zeiträume im Blick als in den Debatten unserer Tage üblich. Er liest in den "Archiven" des Weltklimas und rekonstruiert dessen Verlauf viele zehntausende Jahre zurück. "Archive sind zum Beispiel Ablagerungen von früheren Vergletscherungen oder etwa Seesedimente und Böden, die sich in der Vergangenheit gebildet haben", erläutert Zech. "Aus diesen lassen sich mithilfe moderner quantitativer Methoden die Prozesse, die zur Entstehung von Landschaften geführt haben, sehr genau bestimmen und damit auch Rückschlüsse auf das zur damaligen Zeit herrschende Klima ziehen."
Ein Beispiel: In seiner Diplomarbeit, mit der er 2003 sein Geoökologie-Studium in Bayreuth abschloss, hat Roland Zech die Vergletscherungsgeschichte Zentralasiens untersucht. Mit der Methode der Oberflächenexpositionsdatierung hat er Gesteine aus dem Pamirgebirge in Tadschikistan analysiert und festgestellt, dass die letzte Eiszeit dort ihren Höhepunkt bereits vor etwa 60.000 Jahren erreicht hat. In Europa dagegen erreichten die Eismassen ihre maximale Ausdehnung erst vor etwa 20.000 Jahren. "Klimawandel", so betont der Forscher, "bedeutet nicht, dass sich die Veränderungen auf der ganzen Erde gleichmäßig vollziehen." Es gebe regional große Unterschiede, insbesondere was die Verteilung der Niederschläge angeht.
Kosmische Strahlung lässt Minerale altern
Nach dem Studium wechselte Zech an die Universität Bern, wo er 2006 mit einer Arbeit zur Vergletscherungsgeschichte der Anden in Südamerika promoviert wurde. Auch darin nutzte er vorwiegend die Oberflächenexpositionsdatierung. Dabei werden Radionuklide an Gesteinsoberflächen bestimmt, die durch den Kontakt mit kosmischer Strahlung entstehen. Je länger Gestein kosmischer Strahlung ausgesetzt ist, also nicht von Gletschereis bedeckt, umso mehr reichert sich beispielsweise das Berylliumisotop 10Be an. In den Mineralen ticke eine "chemische Uhr", die man nur ablesen müsse, so der gebürtige Rosenheimer Zech. Es folgten 2008 bis 2010 Forschungsaufenthalte in Pittsburgh und an der Brown University in Rhode Island (USA). Anschließend wechselte Zech zurück in die Schweiz: zunächst an die ETH Zürich und 2014 gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung als Professor an die Uni Bern. Von dort zog es den Vater zweier Töchter nun an die Saale.
Hier möchte Zech auch die Studierenden stärker an das Thema Klimawandel heranführen und bringt seine methodische Expertise derzeit unter anderem in die Neugestaltung des Studiengangs Geographie ein. "Durch die Analyse vergangener Klimaveränderungen lassen sich Ansätze zum Verständnis und vielleicht auch zur besseren Bewältigung der aktuellen Situation finden", ist er überzeugt. Die Vergangenheit sei der Schlüssel zur Zukunft. Außerdem möchte er gerade die künftige Geographen-Generation für ihre Verantwortung sensibilisieren: "Wir sind diejenigen, die Themen wie Klimawandel und nachhaltige Lebensweise in die Gesellschaft tragen müssen." (US)