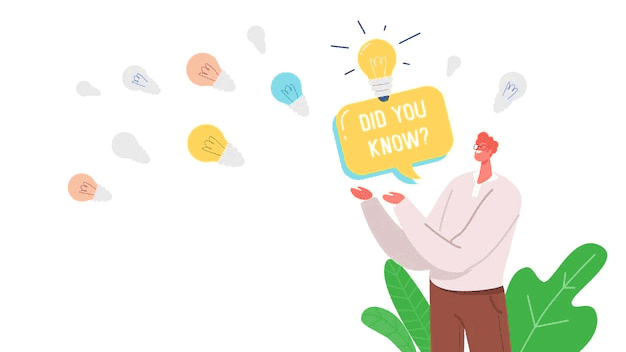
Sechs Fragen an Prof. Dr. Jutta Hübner zum Thema Wissenschaftskommunikation in der Lehre
Prof. Dr. Jutta Hübner
Foto: Anna Schroll/UKJProf. Dr. Jutta Hübner ist seit 2017 Stiftungsprofessorin für Integrative Onkologie der Deutschen Krebshilfe am Universitätsklinikum Jena. Neben ihrer fachlichen Professionalität und ihrem Erfolg als Wissenschaftlerin zeichnet sich Frau Prof. Hübner durch ihr unermüdliches Engagement in der Lehre aus. Innovative Lehrideen, wie die ‚Onkologischen Fallkonferenzen‘, das Projekt zur ‚Digitalen Gesundheitskompetenz‘ oder das Projekt „Querschnitt12 – Kompetenz interfakultär!“, welches im Programm „Freiraum 2022“ von der Stiftung Innovative Hochschullehre gefördert wird, entstammen ihrer Feder. Im Rahmen von Podcasts, Fernsehauftritten und Veröffentlichungen kommuniziert sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse stets so, dass auch Laien sie verstehen und anwenden können.
Was steht Ihrer Meinung nach mit Blick auf die Wissenschaftskommunikation im Vordergrund: Die Verteidigung der Wissenschaft oder die Vermittlung von Wissen?
Aus meiner Sicht muss man Wissenschaft an sich überhaupt nicht verteidigen. Wissenschaft ist unglaublich lebendig und egal, mit welchem Fachgebiet man sich wissenschaftlich befasst, sie hat für alle Menschen wichtige Botschaften. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dürfen wir uns auch nicht mit dem Rücken an die Wand stellen oder in die Defensive bringen lassen. Sicher ist Wissenschaft auch Aufklärung, aber ein proaktives Zugehen auf die Menschen und die Überzeugung davon, dass Wissenschaft toll ist, sind für mich die Kernelemente der Wissenschaftskommunikation.
An Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird oft kritisiert, dass sie eine eigene Sprache sprechen, die nicht jeder und jede versteht. Mit Blick auf die universitäre Lehre: Was benötigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Lehrende aus Ihrer Sicht, um wissenschaftliche Erkenntnisse an Studierende vermitteln zu können?
Sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen ist nicht trivial und gerade das macht sie sehr spannend. Im Prinzip denke ich, benötigen Lehrende die Fähigkeit, ihre Wissenschaft für Laien verständlich auszudrücken. Junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben bereits während ihres Studiums gelernt, sich in der eigenen Fachsprache zurechtzufinden und auszudrücken. Oft gehen sie als Lehrende dann auch so in Lehrveranstaltungen und verwenden nur noch wissenschaftliches Vokabular. Ich würde mir wünschen, dass wir als lehrende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen öfter eine Sprache finden, die auch Laien verstehen. So könnten wir systematisch zwei wesentliche Lehrinhalte vermitteln: Fachwissen und Kompetenzen in der Wissenschaftskommunikation. Die Studierenden, gerade in den ersten Semestern, würden uns Lehrende auf diese Weise viel besser verstehen und sie würden wesentlich besser auf den oft wichtigsten Teil ihrer späteren Arbeit vorbereitet: ihr Wissen zu vermitteln.
Es geht mir dabei nicht darum, die Wissenschaft verbal aus ihrem Elfenbeinturm herauszuziehen, aber man könnte den Slogan ‚Scientists for future‘ ergänzen und sagen: ‚Scientists for future and society‘. Eine gute Zukunft für die kommenden Generationen hängt auch davon ab, wie wir uns der nicht-wissenschaftlichen Gesellschaft annähern und mit unseren Argumenten überzeugen. Auch Schüler und Schülerinnen erreichen wir schon viel früher, wenn wir in einer zugänglichen Sprache auf sie zugehen.
Studierende sind Multiplikatoren in der Wissenschaftskommunikation, sei es durch Kommunikation in Wissenschaft und Gesellschaft ihrer (ersten) aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse oder dadurch, dass sie die zukünftigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind.
Wie erlangen Studierende innerhalb ihres Studiums die notwendigen Fähigkeiten um ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse zielgruppenorientiert zu kommunizieren?
Einen ersten wichtigen Aspekt habe ich bereits genannt: auch wir als lehrende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sollten öfter eine einfache Sprache verwenden, mit der wir den Studierenden als Vorbild dienen.
Außerdem möchte ich mit einem Gedankenspiel antworten: Ideal wäre es, wenn wir die Überprüfung der Lernergebnisse der Studierenden so gestalten, dass wir wirklich nachvollziehen können, dass die Lerninhalte verstanden wurden: als Dialog. Im medizinischen Bereich wird die Lernzielüberprüfung sehr häufig über Multiple-Choice-Fragen durchgeführt. Studierende, die sich auf solche Tests vorbereiten, lernen nicht, wie sie Wissenschaft vermitteln. Sie lernen nicht, wie sie sich konstruktiv mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen, treten nicht in den Dialog und müssen ihr Wissen in dem Sinne nicht anwenden. Ein Dialog, in dem die Studierenden auch kritische Fragen beantworten müssen, mit Nachfragen herausgefordert oder provoziert werden, schult meiner Meinung nach am besten die Kompetenzen in der Wissenschaftskommunikation.
Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, Studierenden explizites Rüstzeug für den Umgang mit (Wissenschafts-)Kritik mitzugeben? Wenn ja, welches Rüstzeug geben Sie Ihren Studierenden mit?
Kritik ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil der Wissenschaft. Seit jeher findet der wissenschaftliche Diskurs auf intellektueller Ebene statt. Auf Konferenzen werden Papiere oder Poster vorgestellt, diskutiert und auch kritisiert. Der Diskurs in unserer Gesellschaft um wissenschaftliche Themen ist hingegen leider nicht immer gewaltfrei und basiert nicht auf Argumentation. Die Angriffe, denen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgesetzt sind, finden eben nicht auf intellektueller Ebene statt. Den Studierenden hier Sicherheit mitzugeben, gute Kenntnisse darüber, was passieren kann und wie man sich wehren kann, ohne dabei den Rückzug anzutreten, halte ich für extrem wichtiges Rüstzeug.
Welche Ansatzpunkte sehen Sie im Bereich innovativer Lehrideen, um den Studierenden den Umgang mit den neuen Medien und der Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte näher zu bringen?
Mein Ansatzpunkt ist es, wirklich an die Basis zu gehen und in Lehrveranstaltungen die Medien selbst als Untersuchungsobjekt zu nutzen. Mit Doktoranden analysieren wir soziale Medien wie Facebook oder Instagram. Für Seminare bereiten wir gerade Lehreinheiten vor, in denen Studierende Inhalte z.B. zur Alternativen Medizin auf Webseiten oder in sozialen Medien analysieren und diskutieren, wie man z.B. mit Patienten kommunizieren kann, die sich aus solchen Quellen informiert haben und im Rahmen des berufsbegleitenden Studienganges E-Health and Communication sehen wir uns an, wie bereits in Gesundheitsberufen Tätige das im Alltag umsetzen können aber auch, wie man Angriffen aus Medien sachlich entgegnet. Was die Studierenden lernen ist dann ein Mix aus fachlichem Lerninhalt und Kommunikationskompetenzen.
Ein weiterer Ansatz, der bisher nicht breit im Bereich der Lehre verfolgt wird, ist, das Thema fächerübergreifend anzugehen. Auch in anderen Fachwissenschaften, mit ganz anderen Fachkulturen gewinnt die Auseinandersetzung und der Umgang mit der nicht-wissenschaftlichen Gesellschaft an Bedeutung. Hier könnte mehr interdisziplinärer Austausch stattfinden und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen könnten voneinander lernen.
Was würden Sie anderen Lehrenden raten, die ihren Studierenden gern mehr Kompetenzen in der Wissenschaftskommunikation vermitteln möchten?
Mein Rat wäre ganz einfach: probieren Sie es doch mal. Man sollte erst einmal anfangen und sich an die Thematik herantasten, schauen, was andere bereits gemacht haben und sich inspirieren lassen. Wenn bei der Umsetzung etwas noch nicht richtig klappt, dann macht man es eben beim nächsten Mal besser. Wichtig ist in meinen Augen, die Studierenden mit ins Boot zu holen und mit Ihnen gemeinsam zu versuchen. Gerade die Anfangssemester haben ja oft noch ein gutes Gespür für Laienkommunikation und sie kennen sich oft besser in den sozialen Medien aus. Was wir dazu entwickeln müssen, ist dann die wissenschaftliche, kritische Denkkultur.
Kontakt
07743 Jena Google Maps – LageplanExterner Link
