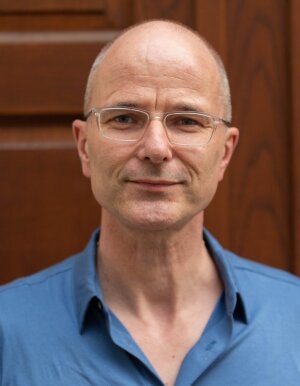Neuberufene 2018
Herzlich Willkommen!
-
Anke Hildebrandt-Kleidon
Denomination: Terrestrische Ökohydrologie
parallel: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)
-
Daniel Zepf
Mehr erfahrenExterner LinkZepf
Foto: UKJ/SzaboNoch völlig leer stehen die Regale im Büro des neuen Direktors der Klinik am Steiger. Die Fachbücher von Professor Florian Daniel Zepf, der im November die Professur für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena angetreten hat, sind im Umzugscontainer von Australien nach Deutschland unterwegs. Der 40-jährige Kinderpsychiater kommt von der westaustralischen Universität in Perth, wo er den Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit klinischer Leitungsfunktion innehatte. In Jena reizt mich die Weiterentwicklung der sehr gut aufgestellten Klinik und das hervorragende wissenschaftliche Umfeld, erklärt Florian Daniel Zepf seinen Wechsel nach Thüringen.
Nach seinem Medizinstudium in Frankfurt am Main begann er am dortigen Universitätsklinikum seine Facharztausbildung. Als erster Preisträger aus Deutschland im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie erhielt Florian Daniel Zepf den Young Minds in Psychiatry Award der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft. Im Rahmen der JARA Translational Brain Medicine Allianz der Uniklinik Aachen (Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- & Jugendalters) und des Forschungszentrums Jülich übernahm er 2009 eine Juniorprofessur für Translationale Hirnforschung und schloss in Aachen seine Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie ab. Hier habilitierte er sich auch mit einer Arbeit zur Untersuchung des Serotoninstoffwechsels im Entwicklungsverlauf, bevor er den Ruf an die University of Western Australia in Australien annahm.
Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena umfasst eine psychiatrische Institutsambulanz, drei Stationen für Kinder, Jugendliche sowie psychosomatisch erkrankte Jugendliche und zwei Tageskliniken mit umfassenden psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten, die von einem multiprofessionellen Team aus Fachärzten, Psychologen und Therapeuten umgesetzt werden. Als Außenstelle betreibt die Klinik zudem eine Ambulanz und eine Tagesklinik in Altenburg. Wir nehmen uns Zeit, um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, und beziehen dabei das familiäre Umfeld ein so Florian Daniel Zepf. Die Kinderpsychiatrie ist ein medizinisches Fach, das viele klinische Berührungspunkte zu weiteren Disziplinen hat, z.B. der Pädiatrie, der Neurologie, der Psychiatrie, Endokrinologie oder Entwicklungspsychologie, das macht sie so spannend.
Die klinischen Schwerpunkte des neuen Klinikdirektors sind die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Aufmerksamkeitsstörungen, mit depressiven Störungen und Geschlechtsidentitätsstörungen. Die wissenschaftlichen Interessen von Professor Zepf gelten neurophysiologischen Untersuchungen bei ADHS und aggressiven Verhaltensstörungen sowie entwicklungspsychologischen Fragen von Impulsivität, Aggression und begleitenden Aspekten. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf neuropharmakologischen Untersuchungen zum Stoffwechsel von Tryptophan, Serotonin und anderen Neurotransmittern. Ein besseres Verständnis der Funktion solcher Substanzen könnte die Behandlung von verschiedenen psychiatrischen Störungsbildern wie zum Beispiel depressiven Störungen unterstützen und ggfs. auch neue Möglichkeiten bei der Diagnostik und Behandlung von eröffnen, so Florian Zepf.
Als derzeitiger President-elect der International Society for Tryptophan Research wird er in zwei Jahren Gastgeber beim nächsten Kongress der Fachgesellschaft sein.(vdG)
-
Juliane von Fircks
Denomination: Kunstgeschichte des Mittelalters
zuvor: Universität Mainz
-
Christina Warinner
Denomination: Microbiome Science
parallel: Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte
-
Matthias Menter
Mehr erfahren enWie lassen sich Wirtschaftswachstum und Innovationen durch politische Entscheidungen fördern? Und welche Rolle spielen besonders starke Wirtschaftsstandorte die sprichwörtlichen Leuchttürme für die Entwicklung der umliegenden Regionen? Solche Fragen stellt sich Juniorprofessor Dr. Matthias Menter in seiner Forschungsarbeit. Und wo ließen sich Antworten darauf wohl besser finden als in Jena, einem der ausgewiesenen Leuchttürme Ostdeutschlands? Hier, an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, ist Menter gerade zum Juniorprofessor für Unternehmensentwicklung, Innovation und wirtschaftlichen Wandel ernannt worden. Zum 1. Oktober nimmt der Wirtschaftswissenschaftler seine Lehr- und Forschungstätigkeit auf. Er gehört damit zu den ersten Professoren, die bundesweit im Rahmen des Tenure-Track-Programms gefördert werden. Im Freistaat Thüringen ist er der erste Inhaber einer solchen Tenure-Track-Professur.
Menter wechselt von der Uni Augsburg nach Jena. In Augsburg hat er Betriebswirtschaftslehre studiert und nach einem anschließenden Master (MBA) in den USA und diversen Stationen in der freien Wirtschaft seit 2014 an seiner Promotion gearbeitet. Unternehmens- und Regionalentwicklung gehören seither zu seinen Forschungsschwerpunkten, für die er an der Uni Jena zahlreiche Anknüpfungspunkte findet.
Für den Wechsel nach Jena war jedoch nicht nur die fachliche Passgenauigkeit ausschlaggebend. Dass es sich um eine Tenure-Track-Professur handelt, ist für mich besonders reizvoll, bietet sie mir doch ein höheres Maß an Planbarkeit und eine frühzeitigere wissenschaftliche Selbstständigkeit, sagt Menter. Der 30-jährige Familienvater plant nun mit seiner Familie nach Jena zu ziehen. Die Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie ist ihm sehr wichtig.
Nachwuchsförderung an der Uni Jena
Exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, wie Matthias Menter, in allem Belangen zu fördern, ist ein erklärtes Ziel der Friedrich-Schiller-Universität. Das betont Universitätspräsident Prof. Dr. Walter Rosenthal, als er Menter seine Ernennungsurkunde überreicht. Wir wollen die Tenure-Track-Professur als einen möglichen Qualifizierungsweg zur Professur dauerhaft an der Universität etablieren und so dem Forschernachwuchs langfristige Perspektiven eröffnen, sagt Rosenthal.
Die Uni Jena hat im Jahr 2017 Mittel für insgesamt 12 Tenure-Track-Professuren eingeworben. Bis 2032 wird sie mit bis zu 11,3 Millionen Euro gefördert. Die von Bund und Ländern getragene Initiative hat zum Ziel, die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses an den deutschen Hochschulen besser planbar und transparenter zu gestalten.(US)
-
Ralf Ehricht
Mehr erfahrenExterner LinkRalf Ehricht
Foto: privat/EhrichtDenomination: Optisch-molekulare Diagnostik und Systemtechnologie
Bis technologische Lösungen aus der Forschung zum Patienten gelangen, vergeht viel Zeit: Rund 14 Jahre dauert es im Durchschnitt bis zur Anwendung in der Praxis.
Diesen Prozess der Translation von der Idee zum Produkt zu beschleunigen, ist ein wesentliches Ziel des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) in Jena. In der neu gegründeten Forschungsabteilung Optisch-molekulare Diagnostik und Systemtechnologie arbeitet ein Team unter Leitung des erfahrenen Industrieforschers Ralf Ehricht an neuen Verfahren für die Diagnose von Infektionskrankheiten und gesellschaftlichen Gesundheitsrisiken. Ehricht, der zuvor als Projektleiter bei dem Jenaer Diagnostik-Unternehmen Abbott (Alere Technologies GmbH) tätig war, wurde von der Friedrich-Schiller-Universität Jena gemeinsam mit dem Leibniz-IPHT als Professor berufen. Seine neue Tätigkeit am Leibniz-IPHT nahm Ehricht im Dezember 2018 auf.Von der Wirtschaft in die Wissenschaft: Für deutsche Verhältnisse ist es ein ungewöhnlicher Wechsel, den Ralf Ehricht nun vollzogen hat. Der Grund? Neugier, sagt der promovierte Biochemiker, der bei Alere Technologies, heute Teil des globalen Konzerns Abbott, seit 2006 den Forschungs- und Entwicklungsbereich Machbarkeitsstudien leitete. Er verantwortete dort zwischenzeitlich die Fertigung der Plattformen ArrayTube und ArrayStrip, mit denen Genom-Analysen durchgeführt werden. Mich reizt die Chance, am Leibniz-IPHT interdisziplinär und mit verschiedenen Technologien arbeiten zu können, so Ralf Ehricht. Für zwei Forschungsschwerpunkte wird er Arbeitsgruppen aufstellen: Wir wollen optisch-molekulare Werkzeuge für die klinische mikrobiologische Diagnostik und Epidemiologie von Infektionskrankheiten erforschen. Und wir wollen die Ergebnisse mit systemtechnologischen Lösungen verknüpfen und so in Verfahren mit einem hohen Technologie-Reifegrad überführen. Dabei will Ehricht eine Brücke schlagen zu Partnern aus der Industrie, mit dem Ziel, gemeinsam innovative und verfügbare Produkte für Diagnostik und Therapie umzusetzen.
Eine Impf-Ampel für jedermann
Damit stärkt das Leibniz-IPHT die Translation: die gezielte Umsetzung von Forschungsergebnissen in anwendungsfähige Lösungen vom Labortisch ans Krankenbett. So können wir Innovationen für die Diagnostik und Therapie schneller in den Gesundheitsmarkt bringen, erläutert Jürgen Popp, wissenschaftlicher Direktor des Instituts. Ralf Ehricht erforscht Infektionskrankheiten und ihre Epidemiologie. Wir wollen verstehen, wie Antibiotika-Resistenzen zustande kommen, um sie zu vermeiden. Dazu setzt er auf moderne bioinformatische Verfahren. Eine beispielhafte Vision, was er auf dieser Grundlage gern als nächstes entwickeln würde, hat Ralf Ehricht auch: eine Impf-Ampel. Verfügbare Tests für jedermann, mit denen man aus einem einzigen Tropfen Blut ablesen kann, ob ein Patient etwa gegen Mumps, Masern, Röteln, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und andere impfpräventable Krankheiten noch immun ist oder welche Impfungen aufgefrischt werden sollten.
Um solche Point-of-Care-Anwendungen zu erforschen, die Ärzten und Patienten diagnostische Untersuchungen vor Ort anstatt über ein Zentrallabor ermöglichen, will Ralf Ehricht Lösungen mit Partnern aus der Industrie erarbeiten. Als Erfolgsmodell für die Zukunft sieht er den von ihm mit aufgebauten Forschungscampus InfectoGnostics in Jena, dem auch das Leibniz-IPHT angehört: eine öffentlich-private Partnerschaft, innerhalb derer mehr als 30 Vertreter aus Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft marktreife Lösungen für die Infektionsdiagnostik erforschen und entwickeln. Woran es in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft oftmals fehlt, ist simple Sprachvermittlung, sagt Ehricht.
Nach seiner Promotion am Institut für Molekulare Biochemie der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist Ehricht 1998 als einer der ersten Mitarbeiter bei der Clondiag Chip Technologies GmbH eingestiegen. Als wissenschaftlicher Projekt- und Gruppenleiter für die Assay-, Device- und Produktentwicklung wirkte er bis 2006 daran mit, das Jenaer Diagnostik-Unternehmen von fünf auf mehr als 550 Mitarbeiter aufzubauen. Begonnen hat das übrigens an einem Labortisch im Lasertechnik-Gebäude des Leibniz-IPHT: Dort startete Eugen Ermantraut Clondiag als Ausgründung aus dem Institut. Mit seinem Antritt am Leibniz-IPHT schließt sich für Ralf Ehricht damit ein Kreis. Und mit Eugen Ermantraut, inzwischen CEO der Firma Blink, arbeitet er heute ebenfalls wieder zusammen: Um Produkte auf die Straße zu bekommen.
(PM IPHT)
-
Dorothee Haroske
Denomination: Funktionenräume
zuvor: Universität Rostock
-
Christina Ehrhardt
Mehr erfahrenChristina Ehrhardt
Foto: UKJGrippeviren und Wirt im Zwiegespräch
Über welche Signalprozesse steuern Influenzaviren ihre Wirtszellen, wie wird die von ihnen hervorgerufene Abwehrreaktion reguliert und welche der wirtseigenen Signalproteine eignen sich als Angriffspunkte für neue Therapiestrategien gegen Influenzavirus Infektionen? Mit diesen Forschungsfragen beschäftigt sich die Biologin Christina Ehrhardt, die seit Herbst 2018 die Sektion für Experimentelle Virologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie leitet. Sie untersucht auch das bislang wenig erforschte molekulare Wechselspiel zwischen verschiedenen Atemwegserregern und dem Wirt, wenn z. B. zur Grippevirus- eine bakterielle Infektion hinzukommt, und trägt so zum Verständnis von Komplikationen im Infektionsverlauf bei.
(vdG)
-
Tobias Rothmund
Mehr erfahrenExterner LinkTobias Rothmund
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Ob es um Fahrverbote für Dieselautos geht, die Rentenpläne der Bundesregierung oder die Zukunft der Europäischen Union: Die öffentliche Meinung zu politischen Streitfragen wird in immer größerem Maße von der Diskussion im Internet geprägt. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena forscht zu diesem Wandel der politischen Debattenkultur seit diesem Semester Prof. Dr. Tobias Rothmund. Der 41-jährige Wissenschaftler hat hier die Professur für Medien- und Kommunikationspsychologie übernommen.
Im Spannungsfeld von Internet und Gesellschaft befasst sich Rothmund vor allem mit dem Verhältnis zwischen digitalen Kommunikationsprozessen und dem politischen Verhalten von Personen. Für den Psychologen verändern soziale Medien die Möglichkeiten der politischen Vernetzung und ermöglichen dem Einzelnen eine stärkere Beteiligung an Kommunikationsprozessen. „Nutzer sozialer Medien neigen zum Beispiel dazu, sich in politischen Fragen mit Gleichgesinnten zu vernetzen“, erläutert Rothmund. „Dieser Zusammenschluss kann konstruktiv sein und soziale Bewegungen auslösen, er kann jedoch auch die Entstehung von Echokammern fördern.“
Unter dem Begriff der „Echokammer“ versteht der Forscher einen Raum in sozialen Netzwerken, in denen sich Nutzer in ihrer politischen Meinung gegenseitig bestärken und zugleich abweichende Meinungen ausblenden. „Diese Form von Gruppendynamik birgt die Gefahr, dass sich Teile der Öffentlichkeit radikalisieren“, unterstreicht Rothmund die Notwendigkeit, dieses Phänomen der digitalen Polarisierung politischer Meinungen zu untersuchen. In weiteren Forschungsthemen geht der Medienpsychologe u. a. den Fragen nach, wie das Erleben von Ungerechtigkeit mit politischen Überzeugungen zusammenhängt und wie „Fake News“ die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft beschädigen.
Tobias Rothmund hat an der Universität Trier Psychologie studiert und arbeitete nach dem Diplom-Abschluss 2004 für zwei Jahre im Bereich der Diagnostik frühkindlicher Entwicklungsverläufe. „Ich wollte mehr über die verschiedenen Formen menschlicher Verhaltensstörungen lernen, habe dann aber gemerkt, dass mich die rationale Durchdringung psychologischer Phänomene am Meisten interessiert,“ erklärt der gebürtige Oberschwabe. Somit begann er 2006 seine wissenschaftliche Karriere an der Universität Koblenz-Landau. Dort wurde er 2010 mit einer Arbeit zur Wirkung gewalthaltiger Videospiele promoviert und war bis zu seinem Wechsel an die Universität Jena als Juniorprofessor für politische Psychologie tätig.
„Für Jena habe ich mich entschieden, weil das Institut für Kommunikationswissenschaft einen exzellenten Ruf besitzt“, erklärt Rothmund. „Kommunikationspsychologie hat hier Tradition und besonders die Forschungsleistungen zum Thema Rechtsextremismus haben mich beeindruckt.“ Als wichtigen Teil seiner Arbeit am Institut für Kommunikationswissenschaft versteht er die forschungsorientierte Lehre. Studierende sollen an seinen wissenschaftlichen Untersuchungen teilhaben können und sich so für die vielfältigen Möglichkeiten der Forschung begeistern.
Soziale Netzwerke erforscht Tobias Rothmund nicht nur, er ist auch selbst in ihnen aktiv. Auf der Plattform Twitter vernetzt er sich mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und teilt seine Erkenntnisse der Öffentlichkeit mit. Warum dort ein paar rote Chilischoten sein Hintergrundbild schmücken? „Das darf man keinesfalls als Hinweis darauf verstehen, dass ich nur scharfe wissenschaftliche Thesen vertrete“, lacht der verheiratete Familienvater. Tatsächlich gärtnert Rothmund in seiner Freizeit und hat die Chilis selbst geerntet. Wenn er sich eingelebt hat, möchte er dem Hobby der Gärtnerei auch in seiner neuen Heimat nachgehen.
-
Johannes Krause
Mehr erfahrenExterner LinkDenomination: Archäogenetik
parallel: Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte
-
Astrid Heutelbeck
Denomination: Arbeitsmedizin
zuvor: Universitätsmedizin Göttingen
-
Timo Mappes
Mehr erfahrenExterner LinkPD Dr.-Ing. Timo Mappes ist zum Professor für Geschichte der Physik mit Schwerpunkt Wissenschaftskommunikation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen worden. Zugleich wird der 41-jährige gebürtige Mannheimer Gründungsdirektor des Deutschen Optischen Museums (D.O.M.), das in Jena entsteht. Mappes nimmt seine Arbeit am 1. Juli 2018 auf.
Wissenschaftler, Manager und Wissenskommunikator"Die Berufungskommission sah sich aufgrund des überaus komplexen Anforderungsprofils der Professur einer sehr schwierigen Aufgabe gegenüber. Sie hatte großes Glück, einen in mehrfacher Hinsicht optimal qualifizierten Bewerber zu finden", sagt Prof. Dr. Dr. h. c. Gerhard G. Paulus, der Vorsitzende der Berufungskommission, und ergänzt schmunzelnd: "Wenn die Kommission sich einen Kandidaten hätte schnitzen können, wäre das Ergebnis dem nun Berufenen sehr ähnlich gewesen". Mappes ist einerseits in der Wissenschaft und der industriellen Forschung und Entwicklung optischer Anwendungen tief verwurzelt, andererseits erarbeitete er sich in den letzten zwei Jahrzehnten in der Dokumentation und Wissenschaftsgeschichte des Mikroskopbaus ab 1800 einen hervorragenden Ruf. Nicht zuletzt hat er gleichzeitig Managementqualitäten und Erfahrungen in der Wissensvermittlung an das allgemeine Publikum, insbesondere an Schülerinnen und Schüler.
All das wird auch dem Deutschen Optischen Museum zugutekommen. Durch die Neukonzeption und den umfassenden Umbau des traditionsreichen Optischen Museums in Jena wird das neue D.O.M. entstehen - ein forschendes Museum und Referenzort für die Darstellung der Geschichte von Optik und Photonik. Es ordnet sich als neuer Partner ein in die bedeutenden wissenschaftlichen Sammlungen und Museen der Friedrich-Schiller-Universität, wo Wissenschaftsgeschichte und -vermittlung weit über Jena hinaus sichtbar gepflegt werden. Zugleich soll das neue Museum eine Begegnungsstätte mit vielfältigen Bildungsangeboten sowie ein Anziehungspunkt in der Stadt und der Region werden. Trägerinstitution des D.O.M. ist die gleichnamige Stiftung, die auch die Finanzierung sichert. Gründungsstifter sind die Ernst-Abbe-Stiftung, die Carl Zeiss AG, die Carl-Zeiss-Stiftung, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und die Stadt Jena.
Das Kuratorium der Stiftung Deutsches Optisches Museum begrüßt die Entscheidung der Berufungskommission. "Wir freuen uns, dass mit Timo Mappes ein Kandidat ausgewählt wurde, der als Wissenschaftler gerade mit seiner ausgewiesenen Managementerfahrung, die er in Leitungsfunktionen in Forschung und Wirtschaft erworben hat, für den anstehenden Umgestaltungsprozess hervorragende Voraussetzungen mitbringt. Seine Kompetenz beim Kuratieren einer wissenschaftlichen Sammlung steht außer Frage, dazu steht er für gute Vernetzung unseres Museums und Einwerben von Drittmitteln für dessen weitere Entwicklung", so Prof. Dr. Thomas Deufel, Mitglied des D.O.M.-Kuratoriums und Vorstandsvorsitzender der Ernst-Abbe-Stiftung.
Wissenschaftliche Vernetzung von Museum, Forschung und LehreSeinen beruflichen Werdegang begann Mappes 2006 nach seiner Promotion zum Dr.-Ing. in Karlsruhe im Konzeptteam für die "Verschmelzung" der Universität Karlsruhe mit dem Forschungszentrum Karlsruhe zum Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Am KIT war der habilitierte Wissenschaftler später auch Leiter einer unabhängigen Nachwuchsforschungsgruppe und Sprecher des Young Investigator Networks und hält dort bis heute Vorlesungen. 2012 wechselte er zu ZEISS. Zuletzt leitete er bei der Carl Zeiss Vision International GmbH die Ressorts Technology and Innovation sowie Information Technology - ein über vier Kontinente aufgestelltes Team für Forschung und Entwicklung. Zu seinen Aufgaben als Direktor des Deutschen Optischen Museums und Professor für Geschichte der Physik der Universität Jena zählt die enge wissenschaftliche Vernetzung von Museum, Forschung und Lehre.
"Ich freue mich darauf, die Zukunft des Deutschen Optischen Museums zu gestalten. Unsere Besucher sollen die physikalischen Grundlagen der Optik selbst erkunden können und neue Technologien in ihrer Anwendung verstehen. Gleichzeitig ist es der Anspruch des D.O.M., die Geschichte der Optik ganzheitlich zu erforschen. Jena ist der Geburtsort der modernen Optik und bis heute herausragend in der Optik- und Photonik-Forschung. Nutzen wir diese Standortvorteile, dann hat das D.O.M. die Chance, eine weltweit führende Einrichtung zu werden. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Museums und den bisherigen und künftigen Partnern werde ich dieses Vorhaben umsetzen", beschreibt Mappes sein Engagement für das D.O.M. (PM)
-
Britt Wildemann
Mehr erfahrenExterner LinkBritt Wildemann
Foto: UKJ/SzaboSehnen übertragen die Kraft der Muskeln auf die Knochen und erfüllen damit im Bewegungsapparat eine wichtige Funktion. Wie wichtig diese ist, wird bei Sehnenerkrankungen oder -verletzungen deutlich, die meist sehr einschränkend, schmerzhaft und langwierig verlaufen. Im Gegensatz zu Muskel- oder Knochengewebe sind die Biologie und das Regenerationsverhalten von Sehnen aber erst seit kurzem in den Fokus der Forschung gerückt, so Britt Wildemann. Damit umreißt die 48-jährige Biologin eines ihrer Forschungsthemen als neue Professorin für Experimentelle Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Jena. Dabei untersucht sie die patientenspezifischen biologischen Eigenschaften der Zellen im Sehnengewebe und fragt nach dem Einfluss von Alter, Geschlecht und Schädigung auf das Regerationspotential.
Die Wissenschaftlerin widmet sich auch den Mechanismen der Knochenheilung und wie diese durch Wachstumsfaktoren und entsprechend ausgestattete Biomaterialien gefördert werden kann. Ein weiterer Aspekt ist die Prävention von Infektionen. An der Charité war Britt Wildemann an der Entwicklung einer Beschichtung beteiligt, die der Ansiedlung von Bakterien auf Implantatmaterial vorbeugt. Die enge Kooperation mit der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie des Uniklinikums, an die ihre Arbeitsgruppe angebunden ist, ist ihr sehr wichtig: Das sichert die Nähe zum Patienten, den wir auch im Labor nie aus den Augen verlieren dürfen. Mit ihren Forschungsthemen sieht sie gerade in den Jenaer Schwerpunktfeldern der Altersmedizin und sowie der Sepsis- und Infektionsmedizin viele Anknüpfungspunkte, sowohl an klinische Partner in der Orthopädie, Rheumatologie oder Mikrobiologie, als auch in der Grundlagenforschung der Zellbiologie oder Materialwissenschaften.
Britt Wildemann hat in Berlin Biologie studiert und wurde mit einem neurobiologischen Thema promoviert. Während des Studiums bzw. der Promotion war sie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover tätig und zu Auslandsaufenthalten in Basel und den USA. Sie wechselte anschließend ins Forschungslabor der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Charité und wandte sich hier den muskuloskelettalen Regenerationsprozessen zu. Der Habilitation im Fach Experimentelle Chirurgie an der Charité folgte dann eine Professur am Berlin-Brandenburger Centrum für Regenerative Therapien.
Ihre Begeisterung für die Forschung und die Kultur des wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt sie in Methodenworkshops, Seminaren zum Problem-orientierten Lernen und Kursen zu guter wissenschaftlicher Praxis. Die Forschungslinie des neigungsorientierten Medizinstudiums in Jena und die medizinnahen Masterstudiengängen bieten dafür sehr gute Möglichkeiten, so Professorin Britt Wildemann.(vdG)
-
Ruprecht von Waldenfels
Mehr erfahrenWie verändern sich Sprachen? Warum verändern sie sich überhaupt? Fragen wie diese faszinieren Ruprecht von Waldenfels. Der neu berufene Professor für Slawistische Philologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena erkundet neue Wege, um den Sprachwandel zu erforschen. Mit Hilfe der Digitalisierung möchte von Waldenfels den Sprachvergleich automatisieren. Nach Jena ist von Waldenfels von Oslo aus gewechselt, hier gebe es die besseren Studierenden, sagt er augenzwinkernd.
„Computer können das nicht besser machen, aber sie sind schneller und verarbeiten gewaltige Datenmengen“, sagt Ruprecht von Waldenfels. Wo bislang mühselig Seite für Seite zwei Texte miteinander verglichen wurden, erkenne die Software rasch Muster und visualisiere sie. Die richtige Einordnung obliegt noch immer dem Wissenschaftler.
Sprachen haben Ruprecht von Waldenfels bereits als Kind in ihren Bann gezogen. Dabei lenkte der 1973 geborene Nachfahre eines fränkischen Adelsgeschlechts schon früh seinen Blick gen Osten: „Der Krieg bildete für unsere Familie die Hintergrundfolie“, sagt von Waldenfels. Eine starke Prägung habe es durch die Mutter gegeben, die als Jugendliche aus dem Sudetenland vertrieben worden war. Polen war ergo ein Urlaubsland für die Familie, gleichwohl verbrachte von Waldenfels mit sieben und 13 je ein Jahr in Kanada. „Ich wuchs mehrsprachig auf, lernte ein Jahr Japanisch und später noch Russisch.“
Um sein Russisch zu vertiefen, besuchte Ruprecht von Waldenfels einen Sprachkurs in Tomsk in Sibirien, während zur gleichen Zeit Panzer durch Moskau rollten. „Es gab den Putsch gegen Gorbatschow, einen letzten Versuch, den Zerfall der Sowjetunion aufzuhalten.“ Für Ruprecht von Waldenfels war die Reise nach Tomsk ein Aufbruch ins Unbekannte, ins Spannende: Er beschloss, seinen Zivildienst ebenfalls in Russland zu leisten. Über einen kleinen Verein der evangelischen Kirche arbeitete von Waldenfels zunächst in einem Moskauer Krankenhaus, wo er als Deutscher, noch dazu aus dem Westen, als „bunter Hund“ angesehen wurde. Eine weitere Station war die Menschenrechtsorganisation „Memorial“.
Nach dem Russland-Aufenthalt wollte Ruprecht von Waldenfels nicht nach Heidelberg zurück. Er ging nach Berlin, nahm dort ein Studium der Politologie, Russistik und Philosophie auf, wechselte später auf Slawistik, Osteuropastudien und Informatik. Um Geld zu verdienen – von Waldenfels war mit 22 das erste Mal Vater geworden – reaktivierte er seine Programmierkenntnisse. Parallel zum Studium arbeitete er bei einer Firma, die automatische Übersetzungssoftware für Englisch-Russisch und Deutsch-Russisch entwickelte. „Erst mit meiner Magisterarbeit bin ich bei der Sprachwissenschaft gelandet“, sagt Ruprecht von Waldenfels. Er schrieb über das Verb „lassen“, seine Arbeit trägt den Titel „Die deutsche analytische Kausativkonstruktion und ihre Äquivalente im Russischen“. Es folgte ein Zwischenspiel in Helsinki – „Finnisch ist eine spannende Sprache!“ – und danach eine Stelle an der Universität Regensburg. Dort entstand die Dissertation „The grammaticalization of give with infinitive complement in Russian, Polish and Czech“. Als Postdoc ging von Waldenfels nach Cottbus, ans Sorbische Institut, von dort aus weiter nach Bern. „In Bern habe ich Methoden für den digitalen Sprachenvergleich weiterentwickelt“, so Ruprecht von Waldenfels. Eine Aufgabe, die ihn auch an der Universität Jena beschäftigt. Weitere Stationen des Wissenschaftlers waren Zürich, Krakau und die University of California, Berkeley.
Zu den Arbeitsgrundlagen von Waldenfels´ gehört zum Beispiel der Roman „Der Meister und Margarita“ digital in 26 verschiedenen Versionen und allen slawischen Sprachen. Mit Hilfe der digitalen Fassungen lassen sich Sprachvergleiche leicht bewerkstelligen. „Wir arbeiten daran, alte theoretische Fragestellungen mit den Möglichkeiten der digitalen Instrumente neu zu beantworten“, sagt von Waldenfels. Ein Ziel sei es, das Arbeitsmaterial als Open Data der Wissenschaftscommunity zur Verfügung zu stellen. Doch die klassische Feldforschung der Sprachwissenschaftler wird damit keineswegs obsolet. Ruprecht von Waldenfels erforscht mit Schweizer Studierenden zusammen innerhalb einer Kooperation der Uni Bern mit Moskau einen russischen Dialekt. Immer wieder fahren die Sprachforscher dafür in ein Dorf, gut tausend Kilometer von Moskau entfernt. Dass die Dialekte auf dem Rückzug sind, ist lange bekannt. „Doch jetzt können wir den Verlust besser dokumentieren und vor allem modulieren und verstehen.“
In Jena möchte Ruprecht von Waldenfels das Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien neu beleben. Er möchte das Interesse von Studentinnen und Studenten für den Osten Europas wecken, für Regionen, die ihn selbst faszinieren, sprachlich und kulturell. Der Vater von drei Töchtern – zwei studieren bereits, die dritte geht nun in Jena zur Schule – hat sich mit der Stadt Jena schon angefreundet. In seiner Freizeit möchte er die Saale erkunden, per Kanu.
(laud)
-
Collin Jacobs
Mehr erfahrenExterner LinkCollin Jacobs
Foto: Heiko Hellmann, UKJUnter Fehlstellungen der Zähne, meist mit Kau- und Funktionsstörungen im Kieferbereich verbunden, leiden nicht nur Kinder und Jugendliche, auch wenn sie die weitaus größte Patientengruppe der Kieferorthopäden darstellt. Die Zahnmediziner können auch Erwachsenen zu einem Gebiss mit besserer Funktion und Ästhetik verhelfen. Relativ jung ist die Therapie von Fehlstellungen, die als Folge von Zahnfleischerkrankungen eintreten. "Nach der Behandlung der Parodontose wird der aus dem Zahnfach getretene Zahn behutsam zurückbewegt. Das ist auch mit Zahnspangen möglich, die an der Innenseite der Zähne befestigt werden", so der neuberufene Professor für Kieferorthopädie am Universitätsklinikum Jena, Collin Jacobs.
Diese Lingualtechnik ist einer der klinischen Schwerpunkte des gebürtigen Göttingers, für den er nach seinen Studienabschlüssen in Human- und Zahnmedizin ein spezielles Masterstudium absolvierte, und den er in seiner Poliklinik am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des Jenaer Uniklinikums etablieren möchte. Von den ästhetischen Vorteilen der nicht sichtbaren Zahnspangen können sowohl Kinder und Jugendliche, als auch Erwachsene profitieren, ebenso von der exakten dreidimensionalen digitalen Abformung des Gebisses, die den unangenehmen Gebissabdruck überflüssig macht.
"Bei der kieferorthopädischen Behandlung Erwachsener muss auch die eventuelle Einnahme von Medikamenten berücksichtigt werden, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen, etwa Wirkstoffe gegen Osteoporose", merkt Collin Jacobs an. Pharmakologische, zellbiologische und immunologische Aspekte von Knochenerneuerung und Gefäßneubildung bringt er als seine Forschungsthemen von der Universitätsmedizin Mainz mit, wo er seine Ausbildung zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie absolvierte, sich habilitierte und zuletzt als Oberarzt arbeitete. Als verantwortlicher Autor einer Studie zur Regulierung von Wachstumsfaktoren durch mechanische Belastung wurde er mit dem Arnold-Biber-Preis der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie ausgezeichnet.
Verschiedene Fachrichtungen greifen ineinanderIn der modernen Kieferorthopädie spielt mehr denn je das Ineinandergreifen verschiedenster Fachrichtungen eine große Rolle, um für den individuellen Patienten das optimale Behandlungsergebnis zu erzielen. Jacobs: "Bei Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Segelspalten ist die Kieferorthopädie ein wichtiger Bestandteil im Zusammenspiel aus Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Phoniatrie, Logopädie und Zahnärzten. Gerade bei diesen Patienten sollten wir nicht allein die Kau-, Sprech- und Kiefergelenksfunktionen verbessern, sondern durch ein ästhetisch ansprechendes Gesamtergebnis auch das Selbstwertgefühl des Patienten steigern."
Von zentraler Bedeutung ist für Collin Jacobs die Kooperation sowohl innerhalb des Universitätsklinikums als auch zu den niedergelassenen Kollegen: "Gerade in enger Abstimmung mit den niedergelassenen Zahnärzten und Kieferorthopäden können bei Kindern und Jugendlichen die besten Ergebnisse erzielt werden, und auch während einer kieferorthopädischen Behandlung ist der Hauszahnarzt stets ein wichtiger Ansprechpartner, sowohl für Eltern und Kind als auch für uns". Dies gilt noch mehr für erwachsene Patienten - hier kann nach einer geringen Zahnregulierung eine bessere prothetische Versorgung vom Hauszahnarzt durchgeführt werden, z. B. mittels Brücken oder Implantaten. Insofern sieht Professor Jacobs "die Poliklinik für Kieferorthopädie auch als eine Anlaufstelle und ein Zentrum des Austauschs für niedergelassene Kollegen - ebenfalls ohne Berührungsängste, denn die Klinik kann von der Praxis und die Praxis von der Klinik lernen."
(vdG)
-
Olaf Beyersdorff
Mehr erfahrenExterner LinkOlaf Beyersdorff
Foto: privat/BeyersdorffOb bei der Internetrecherche oder beim Online-Shopping, der Navigation im Straßenverkehr oder der Bedienung des Smartphones – Algorithmen gehören heute zum Alltag. Und das nicht nur im privaten Umfeld. Auch viele industrielle Produktionsprozesse von technischen Geräten, Gebrauchsgütern oder Arzneimitteln laufen mittlerweile vollautomatisiert ab und nutzen dabei Computer-Algorithmen. "Man kann ohne Zweifel sagen, wir sind in erheblichem Maße von funktionierenden Algorithmen abhängig", konstatiert Prof. Dr. Olaf Beyersdorff von der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Es gibt jedoch auch Probleme – praktische, technische oder rein theoretische –, die sich nicht durch Algorithmen lösen lassen, jedenfalls nicht in annehmbarer Zeit und mit verfügbarem Rechenaufwand. Das sind genau die Fälle, für die sich der Informatiker Beyersdorff interessiert. Der 45-Jährige hat kürzlich den Lehrstuhl für Theoretische Informatik I der Universität Jena übernommen und wechselte dafür von der University of Leeds nach Jena. Seine Berufung an die Universität Jena wird im Rahmen des "Wissenschaftler-Rückkehrprogramms" von der Carl-Zeiss-Stiftung und der German Scholars Organization gefördert.
Beyersdorffs Forschungsschwerpunkt ist die sogenannte Beweiskomplexität. Dieses Teilgebiet der Theoretischen Informatik analysiert logische Probleme und versucht zu klären, warum sich manche von ihnen algorithmisch lösen lassen und andere nicht. Und worin sich diese Probleme unterscheiden. Das seien zunächst rein grundlegende Fragestellungen, sagt der „Vollbluttheoretiker“. Aber dieses Wissen lasse sich immer auch praktisch anwenden. So entwickelt Beyersdorff beispielsweise Modelle, mit denen die Fehleranfälligkeit von Software prognostiziert werden kann. "Wenn ein Computerprogramm sehr komplex ist, gibt es nicht die Möglichkeit, das Programm einfach vollständig durchzuprobieren", so Beyersdorff. In manchen Fällen würde das tausende Jahre dauern und die Rechenleistung selbst der leistungsfähigsten Computer überfordern. In vielen Fällen könne die theoretische Informatik jedoch Wege zur Lösung solch "unlösbarer" Probleme bieten.
Beyersdorff kommt ursprünglich aus Greifswald. An der dortigen Universität hat er Mathematik studiert. Nach dem Vordiplom wechselte er an die Humboldt-Universität nach Berlin und promovierte anschließend in theoretischer Informatik. Bereits damals spezialisierte er sich auf Logik und Komplexität. Nach Abschluss der Promotion (2006) ging er an die Universität Hannover, wo er sich 2011 habilitierte. Zwischen 2009 und 2012 unternahm Beyersdorff drei längere Forschungs- und Lehraufenthalte an der Sapienza Universität in Rom und folgte 2012 einem Ruf an die University of Leeds.
Auch wenn er die Zeit in England als "sehr prägend und wichtig" erachtet, freut sich der zweifache Familienvater nun auf eine neue wissenschaftliche Etappe in Jena. "Die Universität hat einen sehr guten Ruf und eine reiche Tradition." Besonders gefällt es ihm, hier an dem Ort zu forschen und zu lehren, wo Ende des 19. Jahrhunderts Gottlob Frege die Wissenschaft der Logik revolutionierte und damit den Grundstein für sein eigenes Forschungsfeld und die gesamte Logik in Mathematik und Informatik legte. "Ein Jahrhundert zuvor war Goethe für die Universität zuständig als Minister und Schiller quasi Kollege – das finde ich ausgesprochen inspirierend."
In der knapp bemessenen Freizeit von Olaf Beyersdorff nimmt die klassische deutsche Literatur eine wichtige Rolle ein. Seit über 20 Jahren zählt Goethe zu seinen Lieblingsautoren, den er "immer wieder und immer wieder neu" lese. Auch Museums-, Theater- und Opernbesuche unternimmt er mit seiner Familie regelmäßig.
US
-
Sebastiano Bernuzzi
Mehr erfahrenExterner LinkSebastiano Bernuzzi
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Vor mehr als einhundert Jahren sagte Albert Einstein ihre Existenz voraus: Gravitationswellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch unser Universum bewegen und dabei Raum und Zeit in Schwingung versetzen.
Sie entstehen durch jegliche Beschleunigung von Masse, doch ihre Vibrationen sind so unglaublich schwach, dass der Nachweis nur anhand von galaktischen Katastrophen wie aufeinanderprallenden Neutronensternen oder Supernova-Explosionen möglich ist. Erst drei Jahre ist es her, dass Gravitationswellen erstmals nachgewiesen werden konnten, die durch den Zusammenstoß zweier Schwarzer Löcher ausgelöst worden waren. Der Beweis gilt als Meilenstein in der Geschichte der Astrophysik.
An den Vorarbeiten für den Nachweis haben auch Wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena mitgewirkt. Dieses Team wird jetzt verstärkt durch Prof. Dr. Sebastiano Bernuzzi. Der 37-jährige Astrophysiker, der aus Italien nach Jena kam, ist Professor für Gravitationstheorie.
„Mithilfe von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie entwickeln wir Simulationen, die Kollisionen zwischen Lichtjahre von der Erde entfernten Neutronensternen beschreiben“, erklärt Bernuzzi seine Forschung. „Unsere Berechnungen sind sehr komplex, denn neben der Gravitation müssen auch andere Kräfte wie Elektromagnetismus oder nukleare Kräfte berücksichtigt werden.“
Um aus all diesen Faktoren eine präzise Simulation zu erstellen, bedient sich Bernuzzi der Leistung von superschnellen Computersystemen. Die Bedeutung seiner Forschung spiegelt sich auch in der Unterstützung wider, die Bernuzzi durch den Europäischen Forschungsrat erhält. Der Astrophysiker wird seit 2017 mit einem sogenannten „ERC Starting Grant“ unterstützt, den nur vielversprechende Nachwuchswissenschaftler erhalten.
Sebastiano Bernuzzi weiß schon seit einiger Zeit, dass er an der Universität Jena exzellente Bedingungen vorfindet, um seine Modelle weiter zu optimieren. Nachdem er 2009 in seiner Heimatstadt Parma promoviert wurde, forschte er am Theoretisch-Physikalischen Institut in Jena für vier Jahre als Posdoc. „Das war eine sehr schöne und intensive Zeit für mich, in der ich mich als Wissenschaftler weiterentwickelt habe“, blickt der zweifache Familienvater zurück.
Es folgten ein Forschungsaufenthalt an der Eliteuniversität „Caltech“ im kalifornischen Pasadena und – wieder zurück in Parma – die Habilitation im Jahr 2017. „Als sich mir dann die Möglichkeit zur Rückkehr nach Jena bot, habe ich nicht gezögert“, so Bernuzzi. „Durch den klaren Schwerpunkt auf die theoretische Physik ist Jena für mich die beste Umgebung, um meine Forschung und meine Karriere weiter voranzutreiben.
In nächster Zeit möchte er insbesondere die Bestandteile der Emissionen erforschen, die der Zusammenstoß binärer Neutronensterne hinterlässt. „Die Ausstöße wurden bisher kaum untersucht und bieten wahrscheinlich eine Erklärung für die Entstehung schwerer Elemente“, erklärt Bernuzzi. „Dass wir Goldringe tragen, verdanken wir vermutlich der Fusion dieser extrem kompakten Objekte.“
Ein weiteres Ziel seiner Forschung ist das bessere Verständnis der fundamentalen physikalischen Prozesse, welche diesen Phänomenen zugrunde liegen. „Die Kollisionen stellen einzigartige Labore dar, die wir auf der Erde nicht nachbauen können. Das elementare Wissen, das wir durch ihre Erforschung erwerben, ist mittelfristig vielen Bereichen der angewandten Wissenschaft und damit auch der Gesellschaft dienlich.“
(Bayer)
-
Kim Siebenhüner
Mehr erfahrenExterner Link"Eppur si muove" – "Und sie bewegt sich doch", soll Galilei gemurmelt haben, als er den Gerichtssaal verließ. Der Gelehrte hatte sich vor der Römischen Inquisition verantworten müssen, weil seine Schriften zum kopernikanischen System Argwohn erregt hatten. Wie aber erging es den vielen Namenlosen, die vor den Inquisitor treten mussten?
In einer Mischung aus Kulturgeschichte und historischer Kriminalitätsforschung ging Prof. Dr. Kim Siebenhüner dieser Frage nach. Die neu berufene Lehrstuhlinhaberin für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Jena hatte das Glück, als eine der Ersten die Akten der Inquisition bearbeiten zu können, nachdem der Bestand 1999 für die Forschung freigegeben worden war.Insbesondere hat sie die Ehegerichtsakten erforscht. "Das Vergehen der Bigamie wurde zu einem Glaubensdelikt umdefiniert", sagt Kim Siebenhüner, "auf diese Weise wurde das Ehesakrament benutzt, um konfessionelles Terrain zu profilieren, zu sichern und zu erweitern". Viele Fälle kamen durch Selbstanzeigen der Delinquenten vor Gericht – ein Spezifikum der Inquisition, die den Beichtvätern verordnet hatte, derartige Sünder nicht zu absolvieren.
Freilich machten Eheangelegenheiten nur einen kleinen Teil der Gerichtsaktivitäten aus, das Hauptaugenmerk galt der Verfolgung von Häresie, Magie und Hexerei und dem Besitz verbotener Bücher, etwa von Autoren wie Luther und Calvin. Die Inquisitionsakten wertete die gebürtige Essenerin für ihre Promotion in Basel aus.
Ihr Studium der Geschichte, Philosophie und Germanistik hatte die 47-Jährige in Clermont-Ferrand begonnen, später in Freiburg im Breisgau fortgesetzt. Nach einer einjährigen Zwischenstation in Rom ging es nach Basel.
Auf die Promotion folgte ein Postdoc in Oxford, wo sich Kim Siebenhüner mit frühneuzeitlichen Glaubenswechseln befasste. "Der Glaube durchdrang die Lebenswelt", sagt Kim Siebenhüner. "Und die Konversionen zeigen – trotz konfessioneller Kämpfe – wie religiös plural die europäische Landschaft in vielen Regionen war."Nach dem Postdoc wandte sich Kim Siebenhüner einem ganz anderen Forschungsfeld zu: der Geschichte der Dinge und ihrer globalen Zirkulation. Um der Frage nachzugehen, wie mit Gütern umgegangen wurde, was sie ihren Besitzern bedeuteten und wie sie gehandelt und bewirtschaftet wurden, untersuchte Kim Siebenhüner in ihrer Basler Habilitationsschrift zunächst die Geschichte der Juwelen, in dem anschließenden Projekt auf einer Berner Forschungsprofessur die Geschichte der Textilien.
In beiden Fällen ging es darum, Prozesse der frühen Globalisierung zu erhellen und anhand des Umgangs mit Objekten neue Einblicke in die frühneuzeitlichen Gesellschaften zu gewinnen. Nicht nur kostbare Edelsteine, sondern auch Baumwollstoffe wurden aus Indien importiert und veränderten Konsum und materielle Kultur in Europa. "Viele Dinge wurden mehr wertgeschätzt als heute, weil Rohstoffe mühsam zu beschaffen, Materialien kostbar waren und die Herstellung größte Kunstfertigkeit erforderte." Auf jeden Fall sei die Halbwertszeit der Dinge im Vergleich zur Gegenwart hoch gewesen.
In Jena möchte sich Kim Siebenhüner einer etwas anderen materiellen Kultur zuwenden, wobei sie wieder die Religion in den Blick nimmt: "Wie veränderte sich die materielle Kultur durch Reformation und Konfessionalisierung?" Siebenhüner möchte erforschen, was aus den religiösen Alltagsgegenständen wie etwa den Rosenkränzen oder Heiligenbildern wurde, als die Menschen sich dem neuen Glauben zuwandten. Ein noch weitgehend unbeackertes Feld, bei dem die Mutter einer Tochter sicher ihre Studierenden einbeziehen wird. Die Lehre ist Kim Siebenhüner ein wichtiges Anliegen: "Lehren ist kontinuierliches Lernen", so ihr Credo. Das soll in Jena nicht anders sein als in Basel oder Bern.(SL)
-
Pia Bergmann
Mehr erfahrenSprache ist außerordentlich vielseitig. Sie ermöglicht es, mit nur wenigen Mitteln eine schier unbegrenzte Zahl von Bedeutungen auszudrücken. Manchmal erschließen sich diese Bedeutungen aus dem einfachen Wortsinn, zumeist hängen sie aber von der Situation ab, in der ein Gespräch stattfindet. Ein Beispiel: Wenn eine Person „Die Tür ist offen!“ ruft, möchte sie womöglich gar nicht auf die geöffnete Tür hinweisen. Stattdessen fordert sie – indirekt – dazu auf, die Tür zu schließen. Eine Sprachwissenschaftlerin, die sich mit diesen sogenannten pragmatischen Sprachphänomenen beschäftigt, ist Prof. Dr. Pia Bergmann. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat sie die Professur für Germanistische Sprachwissenschaft mit dem Schwerpunkt Pragmatik angetreten.
„Allgemein befasse ich mich mit der Frage, wie Menschen miteinander sprachlich agieren“, erklärt Bergmann. „Jede Art zu kommunizieren zeichnet sich dadurch aus, dass man bestimmte Dinge sagt, doch was man meint, liegt häufig hinter den Worten versteckt.“ Mit ihrer Forschung will Bergmann u. a. diesen versteckten Bedeutungen auf die Spur kommen. Dafür durchforstet sie große Sprach-Datenbanken und entnimmt ihnen Mitschnitte von Alltagsgesprächen. Anhand der Aufzeichnungen hört und sieht sie, wie die beteiligten Personen miteinander aushandeln, was sie eigentlich meinen.
Zwei Äußerungen, die Bergmann aktuell untersucht, sind die Phrasen „weiß nicht“ und „keine Ahnung“. Der 44-jährigen Wissenschaftlerin ist aufgefallen, dass die beiden Formulierungen in Gesprächen häufig zusammenschmelzen und eine neue Funktion im Satzzusammenhang übernehmen. Sie bringen dann nicht mehr nur Unwissen zum Ausdruck, sondern weisen auch darauf hin, dass man etwas vermutet oder eine Schätzung machen möchte. Typisch ist z. B. ein Satz wie: „Heute hatten wir, keine Ahnung, 15 Grad.“ Bergmann interessiert sich für dieses Fallbeispiel besonders, weil es die Pragmatik mit dem Gebiet der Morphologie verbindet, bei der die Architektur von Wörtern im Mittelpunkt steht.
An sprachlichen Erscheinungen wie diesen forscht Bergmann nicht zum Selbstzweck. Ihre Grundlagenforschung kann zur Entwicklung von Spracherkennungs-Software beitragen, die in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. „Siri, Alexa und Co. müssen damit zurechtkommen, dass Menschen etwas nicht ordentlich ausdrücken, verschleifen oder weglassen“, erklärt die Neu-Jenaerin. Die Erforschung der Pragmatik helfe den Programmen zudem dabei, den sprachlichen Sinn zuverlässig zu erfassen. „Einer Maschine möchte man ja nicht dreimal die gleiche Frage stellen, bis sie endlich eine Antwort findet.“
Nach dem Studium in Bonn begann Pia Bergmann ihre wissenschaftliche Laufbahn an der Universität Freiburg, wo sie 2007 über Intonationsverläufe im Kölnischen promoviert wurde. Nach Professur-Vertretungen wurde sie 2016 – ebenfalls in Freiburg – habilitiert und war anschließend als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen tätig. Zwei Jahre später entschloss sie sich dazu, nach Jena zu wechseln. „Ich hatte mehrere Optionen, aber Jena hat mich beim ersten Eindruck überzeugt“, so die junge Wissenschaftlerin. „Es gab nicht nur inhaltlich viele Anknüpfungspunkte, mir wurde auch sofort viel Wertschätzung entgegengebracht.“
So erfüllend die Wissenschaft für Prof. Bergmann auch ist, sie findet es wichtig, ein Gegengewicht zur täglichen Beschäftigung mit Wort- und Satzbausteinen zu haben. „Um auch mal abzuschalten spiele ich in meiner Freizeit relativ intensiv Klavier“, erzählt die gebürtige Odenwälderin. „Angefangen bei Bach gefallen mir klassische Musikstücke am besten.“
-
Marion Reiser
Mehr erfahrenExterner LinkDenomination: Politisches System der Bundesrepublik Deutschland
zuvor: Universität Lüneburg
-
Frank Kipp
Mehr erfahrenExterner LinkPatientensicherheit im Mittelpunkt
Seit dem Sommersemester 2017 hat Frank Kipp die Professur für Krankenhaushygiene inne, die im Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena neu eingerichtet wurde. Der 52-jährige Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie und promovierte Gesundheitswissenschaftler versteht sich vor allem als Netzwerker zwischen Infektionsmedizin, mikrobiologischer Diagnostik, den klinischen Partnern der verschiedensten Fachdisziplinen und der Pflege - mit dem gemeinsamen Ziel, das Auftreten und die Verbreitung von Krankenhausinfektionen zu vermeiden.
Diese Infektionen, die Patienten im Zusammenhang mit einer stationären oder ambulanten Behandlung erwerben, nehmen zahlenmäßig zu, weil die moderne Medizin immer mehr Therapiechancen auch für schwerstkranke, sehr alte und immungeschwächte Patienten eröffnet, aber auch wachsenden Effizienzforderungen genügen soll. Antibiotikaresistenzen machen die Infektionen zudem schwerer behandelbar. "Unser Ziel ist deshalb die effiziente Steuerung der Hygienemaßnahmen in der Klinik, um unsere Patienten bestmöglich zu schützen und zu versorgen", betont Professor Kipp.
Partner in der Klinik, nicht Hygiene-PolizeiDazu gehören natürlich die klassische Hände-Hygiene und der kritische Blick auf Katheter und Kanülen, aber auch rationale Screening- und Diagnostikmethoden. Dabei sieht sich Frank Kipp viel mehr als Partner in der klinischen Versorgung, denn als Hygiene-Polizei. "Gemeinsam mit den Instituten für Humangenetik und Mikrobiologie wollen wir im Haus eine molekularbiologische Erregerdiagnostik mit Hochdurchsatzverfahren etablieren, die innerhalb von drei Tagen eine Aussage darüber liefert, ob Erreger klonal identisch sind oder nicht", so Frank Kipp. Denn erst dann ist gesichert, ob sie von einem Patienten zum anderen übertragen wurden oder nicht.
Als ehemaliger leitender Krankenhaushygieniker im Universitätsklinikum Münster und Ärztlicher Leiter der Westfälischen Akademie für Krankenhaushygiene bringt Professor Kipp große wissenschaftliche und praktische Erfahrung mit. Der gebürtige Niedersachse studierte in Gießen Medizin und in Bielefeld Public Health und wurde in beiden Fächern promoviert. In Münster absolvierte er die Ausbildungen zum Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin sowie für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und habilitierte sich. Zuletzt arbeitet er als Chefarzt des Instituts für Hygiene des DRK-Klinik-Verbundes in Berlin.
"Mit seinen Stärken sowohl in der Sepsisforschung und Infektionsmedizin als auch in der Mikrobiologie ist der Standort einzigartig", beschreibt Frank Kipp seine Motivation, nach Jena zu kommen. Neben Verbünden in der Forschung und Versorgungsnetzwerken ist Jena damit auch besonders attraktiv für junge Mediziner, die diese Richtung für ihre Facharztqualifikation und weitere Spezialisierungen wählen, ist er überzeugt. Entsprechende Lehrangebote sollen die Präsenz des Themas Krankenhaushygiene schon im Studium erhöhen. "Dass das Universitätsklinikum zusätzlich zu den bestehenden Stärken und der hier sehr gut etablierten Krankenhaushygiene eine Professur eingerichtet hat, ist ein klares Bekenntnis, dass es die Versorgungsqualität und die Patientensicherheit weiter steigern will", so Professor Kipp.
-
David Löwenstein
Mehr erfahrenExterner LinkDavid Löwenstein
Foto: privat/LöwensteinDenomination: Philosophie mit Schwerpunkt Logik
zuvor: Universität Frankfurt
-
Anette Grünewald
Mehr erfahrenExterner LinkDenomination: Strafrecht, Strafprozessrecht und ein Grundlagenfach
zuvor: Humboldt Universität Berlin
-
Thomas Kleinlein
Völkerrecht berührt alle Lebensbereiche
Welches Recht gilt im Weltraum? Und wer darf die Bodenschätze ferner Planeten oder Himmelskörper abbauen und damit handeln? Das regelt seit 1967 der Weltraumvertrag, der, inzwischen von über 100 Staaten ratifiziert, das Völkerrecht ins All erweitert hat. Doch spätestens seit der US-Kongress 2015 ein Gesetz beschloss, das die private Eroberung des Alls fördern soll und US-Bürgern das Recht auf außerirdische Ressourcen zubilligt, werden der Weltraumvertrag und die Rechtmäßigkeit des US-Gesetzes kontrovers diskutiert.
Es gibt verschiedene Schichten von VölkerrechtAuch mit solchen Fragen befasst sich Prof. Dr. Thomas Kleinlein an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Den neuen Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht beschäftigen vor allem die internationalen Rechtsperspektiven in seinem breitgefächerten Fachgebiet. Zudem betrachtet er mit großer Sorgfalt die Unterschiede, die historisch, aber auch in den einzelnen Ländern auftreten. "Es gibt verschiedene Schichten von Völkerrecht", betont der 41-jährige gebürtige Nürnberger, der Jura in München und Oxford studiert hat und 2009 in Frankfurt a. M. promoviert wurde. Seine Dissertation untersucht verfassungsrechtliche Entwicklungen im Völkerrecht. Dabei war Thomas Kleinlein nicht nur auf der Suche nach Normen von konstitutionalisiertem Völkerrecht, sondern fragte sich ebenfalls, ob es völkerrechtliche Standards für legitimes Regieren gibt und wie sich die verschiedenen Teilrechtsordnungen des internationalen und innerstaatlichen Rechts zueinander verhalten. Fragen an der Schnittstelle von Recht und Politik griff er auch in seiner Habilitationsschrift auf, die den "Grundrechtsföderalismus" am Beispiel Deutschlands, der USA und der EU untersucht.
Die Leitidee der Forschung des sportlichen Wissenschaftlers ist, "dass globale Herausforderungen wie Klimawandel, Migration, zunehmende Ungleichheit oder die Instabilität und Krisenhaftigkeit der Wirtschaft sowohl für die Problemanalyse als auch für die Erarbeitung von Reformvorschlägen tiefgehende Kenntnisse des einschlägigen Völkerrechts sowie seiner Wechselwirkungen etwa mit dem Recht der Europäischen Union und dem innerstaatlichen Recht erfordern". Auf dieser Grundlage will er mit seinen Promovierenden, aber auch bereits mit den Studierenden diskutieren. Dafür greift Kleinlein, der sich auch didaktisch weitergebildet hat, in seinen Vorlesungen gerne auf aktuelle Beispiele zurück, seien es der Brexit oder das Freihandelsabkommen TTIP, zu denen er selbst forscht. Zugleich betont der Völkerrechtler, dass die philosophischen Grundlagen des "Völkerrechtsdenkens" gerade in einer "Zeit der verlorenen Gewissheiten" von besonderer Bedeutung sind. Auch ihnen widmet sich Kleinlein in Forschung und Lehre. Wichtig ist dem um Internationalität bemühten Wissenschaftler zudem, dass die Studierenden eine "Anleitung zum Lernen" erhalten und sie verstehen, dass das Völkerrecht "inzwischen alle Lebensbereiche tangiert". Außer mit seinen Kerngebieten des Völker- und Europarechts sowie mit dem Verfassungs- und Verwaltungsrecht, der Rechtsphilosophie und der Rechtsvergleichung wird sich der Neu-Jenaer auch mit den eher seltenen Gebieten des Technik-, See-, Weltraum- und Umweltrechts befassen - und seine Ergebnisse, wie bisher, in deutsch- und englischsprachigen Publikationen darlegen.
-
Thomas Cizmar
Mehr erfahrenExterner LinkGehirnzellen bei der Arbeit beobachten
Tomáš Čižmár erforscht neue Methoden zur Kontrolle der Lichtleitung in optischen Fasern. Das Ziel seiner Forschungsaktivitäten ist es, miniaturisierte Fasersonden herzustellen, mit denen er einzelne Gehirnzellen in einem lebenden Organismus bei ihrer "Arbeit" beobachten kann. Indem sie die dabei ablaufenden Prozesse besser verstehen, hoffen Forscher Antworten auf bisher nur unzureichend verstandene biologische Abläufe zu finden. Etwa wie sich Erinnerungen in unserem Gehirn verankern und wie wir sie wieder abrufen. Die Technologie könnte nützlich sein, um den Beginn von Alzheimer oder anderen schweren neurologischen Erkrankungen besser zu verstehen.
Tomáš Čižmár ist seit Jahresbeginn 2018 Professor für Wellenleiteroptik und Faseroptik an der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena und wird am Leibniz-Institut für Photonische Technologien Jena (Leibniz-IPHT) die Abteilung Faseroptik leiten. Die Forschungsgebiete des Physikers umfassen optische Manipulation kleinster Partikel, die Untersuchung von Lichtleitprozessen in optischen Fasern sowie deren Anwendung in haarfeinen endoskopischen Fasersonden für die biomedizinische Bildgebung.
Um hochaufgelöste Bilder aus schwer zugänglichen Körperregionen wie dem Gehirn zu erhalten ohne dabei das Gewebe großflächig zu schädigen, sind haarfeine Endoskopiesonden nötig. Herkömmliche faserbasierte Endoskope wären für solche Eingriffe viel zu groß. Sie bestehen meist aus einem Bündel mehrerer optischer Fasern, in dem jede Faser ein Pixel des Bildes überträgt. Eine von Tomáš Čižmár entwickelte holographische Methode erlaubt es nun, hochaufgelöste Bilder durch eine einzelne, nur ein Zehntel Millimeter dünne, optische Faser zu übertragen. "Die komplexe und schwer vorhersagbare Lichtleitung in solchen multimodalen Fasern verhinderte bis vor Kurzem ihren Einsatz in der Mikroskopie. Die Bildinformationen kamen völlig durcheinander und verzerrt aus der Faser. Mittels digitaler Holographie und Computeralgorithmen ist es uns gelungen, die verzerrten Bilder wiederherzustellen. Die hochauflösende Mikroskopie mit extrem dünnen Fasern öffnet ein Fenster, um Prozesse in vorher unerreichbaren Regionen lebender Organismen zu studieren - eventuell auch irgendwann beim Menschen", so Tomáš Čižmár über die Zukunft der Technologie.
Lichtleitprozesse in multimodalen FasernFür sein Forschungsprojekt LIFEGATE erhielt Tomáš Čižmár den anerkannten Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrats - eine Auszeichnung für exzellente Wissenschaftler. In den kommenden fünf Jahren unterstützt der Forschungsrat das Projekt des 38-jährigen Forschers am Leibniz-IPHT finanziell. Am Institut möchte er zunächst die Lichtleitprozesse in multimodalen Fasern genauer erforschen. Um die Technologie letztendlich auch in der Mikroendoskopie einsetzen zu können, müssen die Fasern vor allem flexibel sein. Das ist eine Herausforderung, denn beim Verbiegen der Fasern verzerrt das übertragene Bild auf unterschiedliche Weise. Eine Lösung des Problems verspricht sich der Forscher von einem genaueren Verständnis der Lichtausbreitung in der Faser. Die bisher relativ langsame Übertragungsgeschwindigkeit möchte Čižmár durch schnellere Grafikprozessoren und bessere Datenverarbeitungsalgorithmen erhöhen. "Am IPHT kann ich eine einzigartige technologische Infrastruktur für meine grundlagenorientierte Forschung im Bereich Faseroptik und -technologie nutzen. Zudem lässt sich die holografische Mikroendoskopie mit den hier etablierten Bildgebungstechniken kombinieren und so die Palette an lichtbasierten Technologien für die Medizin und Biologie erweitern", begründet der gebürtige Tscheche seine Entscheidung nach Jena zu kommen. Parallel zu den Arbeiten am Leibniz-IPHT, forscht er zusammen mit Partnern am Institute of Scientific Instruments in Brno/Tschechien an der Integration der Fasern in Mikroendoskopiesonden und deren experimenteller Anwendung.
Über Tomáš Čižmár
Von 2003 bis 2007 arbeitete der Physiker in der Gruppe von Prof. Pavel Zemánek am Institute of Scientific Instruments der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Masaryk Universität in Brno, wo er im Jahr 2006 auf dem Gebiet der Wellen- und Partikeloptik promoviert wurde. Anschließend forschte Čižmár als Postdoc in der Gruppe von Prof. Kishan Dholakia an der University of St. Andrews, Schottland in zahlreichen Projekten zum Thema optische Manipulation und biomedizinische Photonik. Mit einem Forschungsstipendium wechselte er 2010 von der School of Physics & Astronomy zur School of Medicine, um dort innovative Konzepte für die holographische Endoskopie, ein neues Gebiet der komplexen Photonik, zu etablieren. Bevor Čižmár nach Jena kam war er Dozent an der University of Dundee und University of St. Andrews. In seiner Forschergruppe "Complex Photonics" in Dundee untersuchte er neue Methoden zur optischen Manipulation, Photonik in chaotischen Systemen und Lichtleitungsprozesse in optischen Fasern.