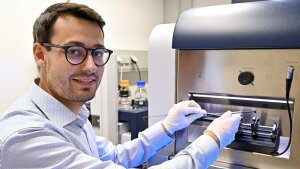Neuberufene 2019
-
Martin Ammon
Mehr erfahrenMartin Ammon
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Denomination: Raumzeit und Materie
zuvor: Universität Jena
-
Jutta Bleidorn
Mehr erfahrenExterner LinkJutta Bleidorn
Foto: Michael Szabó/UKJ„Es ist ein Klischee, dass der Allgemeinmediziner nur laufende Nasen und Fußpilz sieht. In der Hausarztpraxis kann vielmehr eine moderne, umfassende medizinische Versorgung auf dem aktuellen Wissensstand betrieben werden“, stellt Dr. Jutta Bleidorn klar. Die 51-jährige Ärztin hat seit Februar die Professur für Allgemeinmedizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne und leitet das Institut für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Jena. Zukünftigen Ärztinnen und Ärzten eine breite Grundlage zu vermitteln, den hausärztlichen Nachwuchs in Studium und Facharztausbildung auf seine anspruchsvolle Tätigkeit vorzubereiten und dazu den fachlichen Kontakt zwischen der medizinischen Wissenschaft und den praktisch tätigen Hausärzten zu halten – darin sieht sie die Aufgabe der universitären Allgemeinmedizin.
Das seit gut zehn Jahren am Universitätsklinikum Jena bestehende Institut für Allgemeinmedizin bietet dafür gute Bedingungen. „Wir koordinieren die Ambulant-orientierte Linie im Medizinstudium und können dafür auf ein Netzwerk mit 250 qualifizierten Lehrpraxen in Thüringen zurückgreifen, in denen die Studierenden die ambulante ärztliche Tätigkeit intensiv kennenlernen“, so Professorin Jutta Bleidorn. Zudem gestaltet das Institut als Partner im Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Thüringen das Seminarcurriculum und bietet mit seinem Rotationsprogramm eine umfassende und strukturierte Facharztweiterbildung in der Allgemeinmedizin an.
Für Forschungsprojekte in der hausärztlichen Patientenversorgung plant Jutta Bleidorn den Aufbau eines Forschungspraxennetzwerkes: „Wir wollen Hausärzte als Forschungspartner gewinnen, um gemeinsam in methodisch hochwertigen Studien herauszufinden, von welchen Maßnahmen die Patienten in der hausärztlichen Versorgungssituation am meisten profitieren.“ Mit dieser Fragestellung leitete Jutta Bleidorn zum Beispiel eine Doppelblindstudie zur Behandlung von Harnwegsinfekten, die in über 40 Praxen in Niedersachsen durchgeführt wurde. „Dabei wollen wir ganz im Sinne einer translationalen Forschung Fragestellungen aufgreifen, die sich in aus der täglichen Praxis der hausärztlichen Kollegen ergeben. Unsere Ergebnisse sollen schließlich dazu beitragen, dass wir den Patienten nachweislich wirksame Behandlungsalternativen anbieten können.“
Nach ihrem Medizinstudium in Kiel, Freiburg und Göttingen absolvierte Jutta Bleidorn die Facharztausbildung in der Allgemeinmedizin. Danach praktizierte sie als Ärztin und unterrichtete in medizinischen Fachberufen, bevor sie an das Institut für Allgemeinmedizin der MH Hannover wechselte und schwerpunktmäßig zu klinischen Arzneimittelstudien in der hausärztlichen Versorgung forschte - ein Thema, zu dem sie sich auch habilitierte. Neben ihrer Tätigkeit in Forschung und Lehre ist sie in kleinem Umfang weiterhin als Hausärztin tätig. „Ein Hausarzt erlebt seine Patienten in einer viel selbstbestimmteren Lebenssituation als der Kollege in der Klinik und begleitet sie langfristig. Er arbeitet als Generalist“; das schätzt sie an ihrem Beruf. Und sie ist sich sicher, dass dieser nach wie vor attraktiv ist für junge Ärztinnen und Ärzte, wenn die Randbedingungen stimmen.UvdG
-
Christina Brandt
Denomination: Geschichte der Philosophie der Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Lebenswissenschaften
zuvor: Universität Bochum
-
Holger Cartarius
Mehr erfahrenHolger Cartarius
Foto: Friedrich Moritz Eberhardt/FSU JenaExperimente mit Magnetfeldern, Stromkreisen oder schwingenden Pendeln sind fester Bestandteil des Physikunterrichts. Jedoch könnte der Unterricht schon bald um weitere Facetten ergänzt werden. Denn in letzter Zeit hat die Quantenmechanik, die das physikalische Geschehen auf der allerkleinsten Ebene erfasst, gegenüber der klassischen Physik stark an Bedeutung gewonnen – so sehr, dass viele Physikerinnen und Physiker sie verstärkt in die Schulen einbringen möchten. Einer von ihnen ist Prof. Dr. Holger Cartarius, der seit Kurzem an der Friedrich-Schiller-Universität Jena als Professor für Physikdidaktik lehrt. Er entwickelt neue Lehrmethoden für Themen der modernen Physik, die in der Unterrichtspraxis zum Einsatz kommen.
Neben dem Quantencomputer, der aktuell von führenden Technologieunternehmen entwickelt wird, gelte das vor allem für den Bereich der Quantenkryptographie, welche die Übertragung sensibler Daten sicherer machen soll. Das Prinzip: Sender und Empfänger einer Nachricht einigen sich auf einen Quantenschlüssel, den sie z. B. mithilfe verschiedener Polarisationszustände eines Lichtteilchens erstellen. Eine dritte Partei kann somit keine Informationen über den Schlüssel gewinnen, ohne dass ihr Abhören bemerkt werden würde.
Doch wie bildet man angehende Lehrerinnen und Lehrer dazu aus, die komplexe Physik hinter der Quantenkryptographie auch im Klassenraum zu erklären? „Die Quantenphysik liegt weit entfernt von allem, was den Menschen in ihrer Erfahrungswelt unmittelbar zugänglich ist“, sagt Prof. Cartarius. Wer dieses Wissen vermitteln will, müsse daher das Abstrakte besonders anschaulich und spannend erklären sowie auf das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler Rücksicht nehmen.
Darüber hinaus sorgt Cartarius dafür, dass Lehramtsstudierende auch die vielfältigen Themen der klassischen Physik – wie Optik, Mechanik oder Elektrizitätslehre – sicher beherrschen. „Hier besteht die Schwierigkeit darin, dass nicht alle Studierenden das mathematische Handwerkszeug mitbringen, weil sie etwa lieber Biologie oder Sport als zweites Fach unterrichten möchten“, erläutert Cartarius. In einem Lehrprojekt sucht er deshalb nach Möglichkeiten, wie sich solche Unterschiede im Mathematik-Wissen ausgleichen lassen, sodass alle Studierenden gut mitkommen. Ein Lösungsansatz seien Promovierende oder ältere Studierende, die als Mentorinnen und Mentoren Hilfestellung geben können.
Bevor Holger Cartarius nach Jena kam, forschte und lehrte er an der Universität Stuttgart. Nach einem Forschungsaufenthalt am Weizmann-Institut für Wissenschaften in Rehovot (Israel) kehrte er dorthin zurück und habilitierte zum Thema „Quantensysteme mit ausgeglichenem Gewinn und Verlust“. Im Anschluss wechselte er in die Physikdidaktik und baute diesen Bereich in Stuttgart maßgeblich mit auf.
„Die Jenaer Didaktik hat eine lange Tradition“, schwärmt Cartarius von seinem neuen Umfeld. „Besonders gefällt mir der Austausch mit den anderen Fachdidaktiken wie der Chemie, wodurch man schnell gemeinsame Projekte realisieren kann.“ Bestens vernetzt ist Cartarius zudem im Bereich Astronomie, wo er eng mit seinem Vorgänger Prof. Dr. Karl-Heinz Lotze zusammenarbeitet. Gerade die Astronomie könne dabei helfen, physikalisches Wissen zu vertiefen und für den Beruf des Physiklehrers zu begeistern, so Cartarius. Der Blick in die Sterne rufe schließlich von Natur aus Begeisterung bei vielen jungen Menschen hervor.
(Bayer)
-
Christine Czinglar
Mehr erfahrenExterner LinkKinder oder Jugendliche, die aus ihrer Heimat in ein anderes Land ziehen, stehen vor großen Herausforderungen. Sie müssen sich nicht nur an fremde Gepflogenheiten gewöhnen, sondern meist zusätzlich zu ihrer Muttersprache eine zweite Sprache lernen. In Deutschland gibt es dafür an den meisten Schulen Willkommensklassen mit speziell ausgebildeten Lehrkräften. "Für den Start können diese Klassen ein probates Mittel sein", sagt Prof. Dr. Christine Czinglar von der Universität Jena. "Nach kurzer Zeit sollte jedoch der Übergang in Regelklassen erfolgen, wo insgesamt mehr Deutsch gesprochen wird." Wie unbegleitete Minderjährige die deutsche Sprache lernen, hat die neue Professorin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache intensiv erforscht.
Christine Czinglar zufolge stellt der fehlende Bildungshintergrund vieler Jugendlicher eine große Hürde beim Erlernen des Deutschen dar. "Viele können nicht nur nicht richtig lesen und schreiben", sagt die gebürtige Österreicherin. "Wenn sie in ihrer Heimat nicht unterrichtet wurden, fehlt auch das Metawissen darüber, wie Schule und Lernen ganz allgemein funktionieren." Aufgrund der oftmals traumatischen Fluchtsituation sei es für das Lehrpersonal nicht immer einfach zu erkennen, wie viel von diesem Wissen vorhanden ist. Czinglar hat deswegen gemeinsam mit einer ihrer Masterstudentinnen das Testinstrument "Lit-L1-L2" konzipiert, mit dem sich die Lese- und Schreibfähigkeiten auch in der Erstsprache Dari - einer Amtssprache in Afghanistan - bestimmen lassen. Das Instrument will sie an der Universität Jena weiterentwickeln.
Außerdem geht Prof. Czinglar der Frage nach, welche grammatikalischen Besonderheiten für die Jugendlichen zu Stolpersteinen werden. "Die Verben des Deutschen sorgen für Verwirrung, weil sie in Haupt- und Nebensatz an unterschiedlichen Stellen stehen", erklärt die Sprachwissenschaftlerin. Gewöhnungsbedürftig seien auch Häufungen von Konsonanten, etwa in dem Wort "Strumpf", die in den meisten Sprachen nicht üblich sind. Die Forschung dürfe daher nicht nur die deutsche Sprache im Blick haben, sondern müsse auch die Herkunftssprachen berücksichtigen. "Arabisch wird zum Beispiel von rechts nach links gelesen und nach ganz anderen Prinzipien verschriftlicht als das Deutsche. Solche strukturellen Unterschiede haben neben anderen Faktoren wie dem Alter, der Motivation und der Bildung auch einen Einfluss darauf, wie schnell jemand Deutsch lernt."
Christine Czinglar weiß aus eigener Erfahrung, dass der Zweitspracherwerb auch mit großen Anstrengungen verbunden sein kann. Sie wuchs im österreichischen Vorarlberg auf, wo sie als Kind neben der Standardsprache einen alemannischen Dialekt lernte, der im restlichen Österreich nicht vorkommt. Nachdem sie an der Universität Wien allgemeine Sprachwissenschaft studierte, ging sie für fünf Jahre nach Ungarn und arbeitete als Lektorin für den Österreichischen Austauschdienst. Dort lernte Czinglar die ungarische Sprache, die sich in Wortschatz und Grammatik stark von den indogermanischen Sprachen unterscheidet, die man üblicherweise bei uns als Fremdsprachen spricht. Nachdem sie in Wien über das Thema Altersfaktor im Zweitspracherwerb promovierte, folgte der Umzug in die Mitte Deutschlands: Zunächst forschte und lehrte sie als Juniorprofessorin an der Universität Kassel, bevor sie nun nach Jena kam.
Dort hat sich Christine Czinglar bereits gut eingelebt. "Besonders gefällt mir, dass es hier so viele internationale Studierende gibt", sagt die Sprachforscherin. In der Lehre will sie die Studierenden nicht nur unterrichten, sondern aktiv in die Forschung einbinden. Zum Beispiel in ihrem nächsten Projekt, das den Sprach- und Schrifterwerb von Erwachsenen untersuchen wird.
-
Veronika Engert
V. Engert
Foto: Max Niemann PhotographyEin klares „Ja“ antwortet Prof. Dr. Veronika Engert auf die Frage, ob Stress ansteckend ist. „Wenn Menschen eine Stresssituation, zum Beispiel ein Prüfungsgespräch, miterleben, dann können wir unmittelbar einen erhöhten Hormonspiegel im Blut feststellen, auch wenn sie nicht selbst geprüft werden. Diese Reaktion gehört zu unserem sozialen Wesen, sie ist umso stärker ausgeprägt, desto enger wir dem Prüfling verbunden sind“, ergänzt die 44-jährige Psychologin. Sie hat seit dem vergangenen Wintersemester die Professur für Soziale Neurowissenschaft am Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Jena inne. Eines ihrer Forschungsgebiete beschäftigt sich damit, wie diese Stressübertragung vermittelt wird, zum Beispiel zwischen Mutter und Kind.
Ein anderer Schwerpunkt sind die Auswirkungen von chronischem Stress oder der Einfluss früher Lebenserfahrungen auf die langfristige Stressregulation. Diese Langzeitveränderungen können zu neurologischen, metabolischen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen, die auch mit dem Älterwerden assoziiert sind. Mit Hilfe labormedizinischer Untersuchungen und Hirnbildgebungsverfahren wie Magnetresonanztomographie untersucht Veronika Engert, wie Stress die Widerstandfähigkeit von Seele und Körper schwächt und warum die individuellen Unterschiede darin so groß sind. „Dabei interessiert uns besonders, wie sich mentales Training auswirkt und ob wir diese Wirkung physiologisch nachweisen können“, so Veronika Engert.
Schon in ihrem Psychologiestudium an der Universität Trier beschäftigte sich die Wissenschaftlerin mit den psychobiologischen Aspekten von Stress. In ihrer Promotion untersuchte sie den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen und elterlicher Fürsorge auf die Wirkung von ADHS-Medikamenten. Nach einem mehrjährigen Forschungssaufenthalt an der McGill University in Montreal wechselte sie an das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, um auch zur Wirkung von Trainingsinterventionen zu forschen. Sie leitet hier die Forschungsgruppe „Sozialer Stress und Familiengesundheit“, die sie auch weiterhin betreuen wird.
In Jena findet Veronika Engert starke Kooperationspartner an Universität und Klinikum. Viele Anknüpfungspunkte sieht sie zum Beispiel für die Untersuchung der Empathie-abhängigen physiologischen Stressresonanz innerhalb der Patient-Therapeut-Beziehung oder die Fortführung der Stressinterventionsforschung auch für Patienten mit klinischen Erkrankungen, vor allem im Bereich der Alterserkrankungen. Mit Lehrveranstaltungen im Bereich der Psychoneuroendokrinologie möchte Professorin Engert Studierende sowohl in der Psychologie als auch in der Medizin für ihr Fachgebiet interessieren und sie in studentischen Projekten an die Forschungsarbeit heranzuführen. Gern ist die Mutter von drei Kindern Mentorin für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Vorbild dafür, dass sich der Koordinationsstress von Forschungstätigkeit und Familienleben bewältigen lässt.
(vdG/UKJ)
-
Diana Forker
Mehr erfahrenExterner LinkDiana Forker
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Diana Forker hat ihr Eldorado in Dagestan gefunden. Das kleine Land im Kaukasus – etwa so groß wie Niedersachsen – hat gerade mal gut 2,9 Millionen Einwohner, doch die sprechen 30 bis 40 verschiedene Sprachen. Die ungenaue Zahl ergibt sich, weil selbst Experten sich nicht einig sind, wo die Grenze zwischen Dialekt und Sprache verläuft. Diese Sprachenvielfalt ist Diana Forkers Forschungsgegenstand: Die 39-jährige Wissenschaftlerin wurde gerade auf die Professur für Kaukasusstudien mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaften an der Universität Jena berufen.
„Wenn wir uns viele Sprachen anschauen, lernen wir zu verstehen, wie menschliche Sprache überhaupt funktioniert“, sagt Prof. Dr. Diana Forker. Eng verknüpft sei zudem das Denken mit der Sprache. So ist die Sprachwissenschaftlerin Forker bei der Analyse verschiedener Sprachen auf der Suche nach Mustern, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar machen. „Sprachen verändern sich – sie werden effektiver – und wir schauen, wo wir die dahinterliegenden Muster erkennen können“, sagt Diana Forker. Aktuell befasst sie sich mit westkaukasischen Sprachen, etwa der Sprache der Tscherkessen. Dieses Volk lebt großteils weit verstreut in der Diaspora, allein in der Türkei leben etwa drei Millionen Tscherkessen, in Deutschland sind es ca. 30.000. Der wohl prominenteste von ihnen ist der Grünen-Politiker Cem Özdemir.
Diana Forker möchte in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte die Sprachevolution erforschen: „Wie entstehen Sprachen? Wie verbreiten sie sich?“ Spannend sei es zum Beispiel zu ergründen, welchen Ursprung das Indoeuropäische hat. Ähnlich wie in der Evolutionsbiologie könne man dazu einen Stammbaum erstellen, doch zunächst müsse ein ausreichender Bestand an Daten gesammelt werden. Ein Instrument dafür wird eine lexikalische Datenbank sein, mit deren Hilfe die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise nach Lehnwörtern suchen können.
Diana Forker wurde in Lauchhammer geboren und lebte als Kind auf Rügen und später in Erfurt, wo sie zur Schule ging. Während eines einjährigen Aufenthalts in Moskau lernte sie eine Frau aus Dagestan kennen, die sie in ihrer Heimat besuchte. Die Freundschaft mit ihr hält bis heute – und Diana Forker lernte den Kaukasus kennen. Zu studieren begann sie in Pisa, zunächst Philosophie, später nahm sie noch Logik und Linguistik hinzu und wechselte nach Leipzig. Am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie war Forker zunächst wissenschaftliche Hilfskraft bei Professor Bernard Comrie, einem englischen Linguisten. Hier entstand ihre Doktorarbeit „A grammar of Hinuq“, die Grammatik einer kleinen kaukasischen Sprache. Die Arbeit wurde mehrfach mit Preisen gekrönt: Forker erhielt den Dissertationspreis der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft und den Georg-von-der-Gabelentz-Preis der Gesellschaft für linguistische Typologie. Als preiswürdig wurde später zudem ihre an der Universität Bamberg eingereichte Habilitation über grammatische Themen in kaukasischen Sprachen angesehen; Diana Forker erhielt den Habilitations-Preis der Uni Bamberg. Wie hochkarätig ihre Forschungen eingeschätzt werden, spiegelt sich auch in der Berufung an die Universität Jena wider: Diana Forker erhielt den Zuschlag als Heisenberg-Professorin – das heißt, auf die Dauer von fünf Jahren wird ihre Professur durch das Heisenberg-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Über ihre Berufung freut sich auch der Dekan der Philosophischen Fakultät, Prof. Dr. Stefan Matuschek, weil „die Kaukasiologie mit Diana Forker nun sehr gut in die Sprachwissenschaften an unserer Fakultät eingebunden ist und deren gemeinsame Forschungsperspektive stärkt.“
In Jena möchte Prof. Dr. Diana Forker die Kaukasusstudien weiter entwickeln und das Fach bekannter machen. „Die Kaukasiologie ist eine schöne Ergänzung zu Fächern wie Politikwissenschaften, Slawistik oder Volkskunde beziehungsweise Kulturwissenschaft“, sagt die Mutter zweier Kinder. Akzente möchte Diana Forker deshalb in der Lehre setzen und sie hofft, noch mehr Studierende für die Richtung zu begeistern. Aktuell sind es nur wenige Studierende, die sie unterrichtet: „Noch kann ich mir alle Namen merken!“
In ihrer Freizeit gehört die Liebe dem Zirkus: Diana Forker ist aktiv im Verein „Bamberger Zirkus-Varieté“, wo sie zweimal in der Woche trainiert. Von der Rhythmischen Sportgymnastik kommend, begann sie mit Tuch, Seil und dann am Trapez zu trainieren. Aktuell versucht sie sich am „Cyr Wheel“, einer Art Rhönrad.
-
Philipp Franken
Denomination: Molekulare Phytopathologie
zuvor: Humboldt Universität Berlin
-
Petra Frehe-Halliwell
Mehr erfahrenPetra Frehe-Halliwell
Foto: Anne Günther (Universität Jena)„Das Spannende an meiner Arbeit ist das Wandeln zwischen den Disziplinen, die Verbindung von Wirtschaft und Pädagogik“, sagt Petra Frehe-Halliwell. Es gebe sehr vielfältige Forschungsfelder, die zu beackern sich lohne, so die 38-jährige Wissenschaftlerin, die neu auf den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik der Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen wurde.
Reizvoll sei für sie ebenfalls die Verzahnung von Theorie und Praxis – eine Verzahnung, die Petra Frehe-Halliwell in ihrer Biografie vorgelebt hat. Aus einer Familie mit landwirtschaftlichem Betrieb stammend, war sie die Erste, die das Abitur ablegte. Daran schloss sich – dem elterlichen Rat folgend – eine Lehre zur Bankkauffrau bei der Sparkasse an. In dieser Zeit reifte der Gedanke, Wirtschaftspädagogik in Paderborn zu studieren.
„Als studentische Hilfskraft arbeitete ich an interessanten Forschungsprojekten mit“, sagt Frehe-Halliwell. Am Ende stand die Dissertation: „Auf dem Weg zu einer entwicklungsförderlichen Didaktik am Übergang Schule-Beruf“. Die Forschungsschwerpunkte der jungen Wissenschaftlerin waren schon damals Inklusion, Integration und individuelle Förderung. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
„Aktuell beschäftige ich mich mit den Problemen von Jugendlichen in der Berufs- und Ausbildungsvorbereitung“, sagt Frehe-Halliwell. Es gehe dabei um eine Gruppe von stark benachteiligten jungen Menschen, denen kaum Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt eingeräumt werden. Sei es wegen fehlender Zeugnisse, familiärer Probleme oder schlechter Sprachkenntnisse. Hier gelte es, die Stärken hervorzuheben und nicht immer die Defizite zu betonen, sagt Prof. Frehe-Halliwell: „Die Herangehensweise muss potenzial-orientiert sein: Jeder hat doch individuelle Stärken!“ Dieser Befund gelte auch im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen.
Die Ausrichtung der eigenen Forschungsthemen an der konkreten Praxis färbt bei Petra Frehe-Halliwell auch auf die Lehre ab: „Meine Studierenden sollen eine forschende Haltung einnehmen, schon wenn sie Praktika absolvieren.“ Heißt konkret, wenn sie etwa in einer Berufsschule hospitieren und feststellen, dass immerfort der Unterricht gestört wird, sollen sie analysieren, weshalb es laut ist und wann es laut ist. Das Ziel sei es, aus der Analyse der Situation Lösungsansätze zu entwickeln, eigene Ideen zu kreieren.
Petra Frehe-Halliwell stammt aus Ibbenbüren. Die 38-jährige Professorin ist verheiratet, als Freizeitbeschäftigungen nennt sie Lesen und Reisen. Früher habe sie noch Handball gespielt, doch dazu fehle jetzt die Zeit.
Die eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen, das habe sie schon während ihrer Lehre zur Bankkauffrau gelernt, sagt Prof. Frehe-Halliwell. Von den Erfahrungen zehre sie bis heute. So falle es ihr leicht, beispielsweise ihre eigene Lehrtätigkeit auf den Prüfstand zu stellen und sogar zum Gegenstand der eigenen Forschung zu machen. Das Wandeln zwischen den Disziplinen bringe auch hier neue Erkenntnisse.
-
Dietmar Gallistl
Mehr erfahrenExterner LinkDietmar Gallistl
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Pionierarbeit in der Wissenschaft leisten und Antworten auf Zukunftsfragen finden – bei dieser Aufgabe unterstützt der Europäische Forschungsrat (European Research Council – ERC) jährlich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem ERC Starting Grant. Dieser stellt bis zu 1,5 Millionen Euro für die Arbeit einer eigenen Forschungsgruppe zur Verfügung. Fünf Jahre lang können die Ausgezeichneten so einer innovativen Projektidee folgen. Eine solche Förderung erhält in diesem Jahr Prof. Dr. Dietmar Gallistl von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Der Mathematiker möchte im Rahmen seines Projektes „Discretization and adaptive approximation of fully nonlinear equations“ (DAFNE) neue numerische Verfahren für eine Klasse von Differentialgleichungen ergründen, um so ihr Potenzial für mögliche Anwendungen zu erweitern.
„Ich freue mich sehr über die Förderung, da sie mir in den kommenden fünf Jahren Zeit, Freiraum und Flexibilität bietet, ein derartiges Forschungsvorhaben umzusetzen – und das gemeinsam mit einem jungen, kreativen Team“, sagt Dietmar Gallistl von der Universität Jena, der mit den Drittmitteln in Höhe von 1,45 Millionen Euro Stellen für zwei Postdocs und zwei Doktoranden finanzieren will. „Zum einen bestätigt uns der ERC Starting Grant einmal mehr, dass wir mit Prof. Gallistl einen exzellenten jungen Wissenschaftler für die Friedrich-Schiller-Universität gewonnen haben. Zum anderen zeichnet eine solche Förderung immer auch die Projektideen aus, die sich in den kommenden Jahren zu vielversprechenden Forschungsschwerpunkten an unserer Universität entwickeln können“, würdigt Prof. Dr. Georg Pohnert, Vizepräsident für Forschung der Universität Jena, den Erfolg des Kollegen, der seit dem vergangenen Wintersemester in Jena forscht.
Dietmar Gallistl, der vor allem Grundlagenforschung im Bereich der numerischen Mathematik betreibt, ergründet in den kommenden Jahren, wie sich die sogenannte Finite-Elemente-Methode auf die Klasse der voll nichtlinearen Gleichungen anwenden lässt. „In der Numerik finden wir Wege, um Gleichungen nicht nur zu beschreiben und ihre Beschaffenheit zu analysieren, sondern um sie tatsächlich auch näherungsweise zu lösen – und das möglichst effizient“, erklärt der 33-Jährige. „In der Regel nutzen wir dafür Algorithmen, die heutzutage meist mittels moderner Rechentechnik angewendet werden.“ Doch auch solche Computer stoßen bei der Rechenleistung an Grenzen, weswegen es notwendig ist, kontinuierliche – also eine unendlich große Zahlenmenge umfassende – mathematische Problemstellungen in handhabbare Teilgebiete einzuteilen und sich somit der Lösung einer Gleichung so genau wie möglich anzunähern. Dieses Vorgehen nennt man Diskretisierung. Ein Verfahren dafür ist die sogenannte Finite-Elemente-Methode, durch die beispielsweise ein Körper in viele kleine Elemente aufgeteilt wird. „Sie kommt etwa häufig in den Ingenieurwissenschaften zum Einsatz, beispielsweise im Bauwesen bei der Berechnung der Verformung elastischer Festkörper“, informiert der Mathematiker.
Die Diskretisierungsmethode lässt sich möglicherweise auch auf andere Gleichungsklassen übertragen – etwa auf die sogenannten voll nichtlinearen Gleichungen. Diese finden eher da Anwendung, wo Probleme nicht physikalisch oder mechanisch modelliert werden, beispielsweise in der Finanzmathematik oder der Geometrie. Bislang sind solche adaptiven Verfahren wie die Finite-Elemente-Methode bei dieser Klasse von Gleichungen wenig erforscht. Genau das will Dietmar Gallistl nun ändern: „Mein Ziel ist es herauszufinden, wie man durch gewisse Regularisierungen zunächst im zweidimensionalen Fall ermöglicht, finite Elemente für gewisse voll nichtlineare Gleichungen zu verwenden – dabei soll der Rechenaufwand möglichst gering und die Näherung an die Lösung möglichst genau sein.“ Eventuell lässt sich mit dieser Grundlagenforschung die Basis für neue Algorithmen in den Anwendungsgebieten der voll nichtlinearen Gleichungen legen.
(Hollstein)
-
Nikolaus Gaßler
Nikolaus Gaßler
Foto: UKJ/Szabó„Ich bin nicht Pathologe geworden, sondern geblieben“, beschreibt Prof. Dr. Nikolaus Gaßler die Entscheidung für sein Fach. Gewebeuntersuchungen in der Augenmedizin und die Möglichkeit, den Patienten anhand dieser Untersuchungsergebnisse den Hergang und die Heilungsaussichten ihrer Erkrankung genau erläutern zu können, haben ihn als jungen Arzt im Praktikum fasziniert. Seit April hat der 50-Jährige die Professur für Pathologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne und leitet die Sektion für Pathologie am Universitätsklinikum Jena. Ihn reizen die fachlichen und organisatorischen Anforderungen, die der moderne interdisziplinäre Klinikbetrieb unter Einbindung externer Partner an die Pathologie stellt.
Gerade in der interdisziplinären Tumordiagnostik wächst neben der mikroskopischen Beurteilung von Zellen und Geweben die Bedeutung der molekularpathologischen Diagnostik, die in den Proben nach Veränderungen charakteristischer Gene und Genprodukten fahndet. Dies ist die Grundlage für eine umfassende „morphomolekulare Diagnose“ und sich dadurch ergebende individualisierte Therapiekonzepte. Zur Qualitätskontrolle klinischer Prozesse trägt das Tätigkeitsspektrum der Pathologie entscheidend bei. Unter anderem ist hier auch die Obduktionstätigkeit zu nennen. „Im Sinne einer zentralen klinischen Dienstleistung wollen wir die Abläufe der umfassenden diagnostischen Tätigkeit weiter optimieren und in Kooperation mit den Instituten für Humangenetik und Rechtsmedizin eine interdisziplinäre Diagnostikplattform aufbauen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Weiterführung der Digitalisierung“, so der Pathologe.
Sein Medizinstudium absolvierte Nikolaus Gaßler in Leipzig, wo er auch promoviert wurde. Anschließend forschte er als DFG-Stipendiat an der Universität Heidelberg und absolvierte am dortigen Universitätsklinikum die Facharztausbildung in der Pathologie. Für seine Habilitation erforschte und charakterisierte Gaßler ein Enzym, das im Dünndarm eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung langkettiger Fettsäuren spielt. 2005 folgte er dem Ruf auf eine Professur an das Universitätsklinikum der RWTH Aachen, wo er als leitender Oberarzt tätig war und die stellvertretende Leitung des Instituts für Pathologie innehatte. Parallel absolvierte er ein Fernstudium der Volkswirtschaftslehre und Geschichte. Zuletzt leitete er als Chefarzt das Institut für Pathologie am Klinikum Braunschweig.
Neben Untersuchungen zum Fettstoffwechsel liegen die wissenschaftlichen Schwerpunkte von Prof. Gaßler in der Erforschung der Mechanismen von Entzündung und Tumorentstehung sowie in der Wechselbeziehung von Darmbakterien und menschlichem Organismus. Nikolaus Gaßler: „Das Mikrobiom im Darm beeinflusst die Entstehung chronischer Erkrankungen in Leber und Darm, wir beginnen gerade zu verstehen, wie. Inzwischen wissen wir auch, dass die Darmbakterien die Komposition von Signalstoffen beeinflusst, die entscheidend für zentralnervöse Funktionen sind.“ Für diese Themen sieht er ideale Anknüpfungspunkte an die Jenaer Schwerpunkte Infektion und Altern, aber auch in der medizinischen Photonik, zum Beispiel im Bereich der Fluoreszenzbildgebung. In der klinischen Forschung möchte Gaßler unter anderem die in der Jenaer Pathologie aufgebaute Expertise in der Interpretation von Weichgewebstumoren fortführen. „Die Pathologie hat naturgemäß eine Mittlerfunktion zwischen Labor und Klinik, diese Rolle wollen wir als Partner in der translationalen Forschung ausfüllen“, so Gaßler.
Dass das umfangreiche und lernintensive Fach bei den Studierenden nicht ganz so hoch im Kurs steht, tut dem Engagement des neuen Pathologieprofessors keinen Abbruch: „Die Studierenden lernen bei uns, warum und wie sich Zellen, Gewebe und Organe bei Krankheiten verändern. Es wird ihnen ein grundlegendes Krankheitsverständnis vermittelt, das letztlich unentbehrlich für ihre zukünftige ärztliche Tätigkeit ist.“ Aus Heidelberg und Aachen bringt Nikolaus Gaßler große Erfahrungen mit dem Modell- und dem reformierten Medizinstudium mit, die er in das neigungsorientierte Studium in Jena einfließen lassen möchte.
(vdG)
-
Johannes Grave
Johannes Grave
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Das Gemälde Allegoria sacra des venezianischen Malers Giovanni Bellini (um 1437-1516) ist nicht leicht zu durchschauen. Reich an kräftigen Farben zeigt es eine felsige Landschaft mit vielen biblischen Figuren wie Maria, Paulus und Hiob. Doch die Anordnung dieser Figuren erscheint willkürlich und ein Gesamtzusammenhang erschließt sich nicht sofort. "Bellini hat das Bild bewusst rätselhaft gestaltet, um eine freie Meditation zu ermöglichen", sagt Prof. Dr. Johannes Grave von der Universität Jena. Mit Bellini, einem Ausnahmekünstler der italienischen Frührenaissance, hat sich der neue Professor für Kunstgeschichte eingehend beschäftigt.
In seinem jüngst veröffentlichten Bildband über Bellini stellt Grave die Allegoria sacra, zu der schon einige komplexe Interpretationsversuche vorliegen, bewusst an den Anfang. "Ich möchte damit zeigen, dass sich Bellinis Kunst gerade nicht wie bei einem Rebusrätsel auf ein eindeutig vorherbestimmtes Ziel hin interpretieren lässt", erklärt der 43-Jährige. "Das Gemälde fordert den Betrachter vielmehr dazu auf, den Blick schweifen zu lassen, um so ein freies Assoziieren und Meditieren zu ermöglichen." Diese Annahme stützt Grave nicht nur auf die künstlerische Darstellung, sondern auch auf die soziale Rolle, die das im 15. Jahrhundert entstandene Bild einmal spielte. "Es diente vermutlich der christlichen Andacht, die damals gut und gerne eine Stunde dauern konnte", erläutert Grave. "Die Bilder mussten so gemalt sein, dass sie dem Betrachter ständig neue Anregungen vermitteln konnten, wenn er so lange davor betete."
Aus seiner Bellini-Forschung zieht Prof. Grave nicht nur Schlüsse über die kunsthistorische Epoche der Frührenaissance, sondern auch über Fragen der allgemeinen Bildtheorie. Grave zufolge setzen Betrachter den schweifenden Blick, den Bellinis Kunst einfordert, auch bei anderen Bildern und Fotografien ein. "Wenn wir uns Bilder anschauen, sehen wir niemals alles auf einen Schlag, sondern machen nach und nach unterschiedliche, manchmal widersprüchliche Beobachtungen", erklärt der Kunsthistoriker. "Schon nach einem kurzen Moment kann es sein, dass wir uns nicht mehr auf die gemalten Figuren, sondern auf die Pinselstriche konzentrieren. Viele Bilder machen sich genau das zunutze. Indem sie uns in diese zeitlichen Wahrnehmungsprozesse verstricken, können sie schließlich Macht über uns gewinnen."
Mit seiner Berufung an die Universität Jena kehrt Johannes Grave auch an die Stätte seiner Promotion zurück. Als Professor für Kunstgeschichte folgt er nun auf seinen Doktorvater Prof. Dr. Reinhard Wegner, der gerade in den Ruhestand getreten ist. "Es ist spannend, nach 15 Jahren wieder in dieser quirligen Studentenstadt zu sein", findet der gebürtige Emsländer. "Vieles ist mir noch vertraut, aber die Stadt und die Universität haben sich auch spürbar weiterentwickelt."
Neben seiner Arbeit als Universitätsprofessor will sich Grave, der schon seit einigen Jahren mit der Klassik Stiftung Weimar zusammenarbeitet, auch in die hiesige Museumslandschaft einbringen. Dort will er Fachwissen aus seinem zweiten Forschungsschwerpunkt, der kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik um das Jahr 1800, einbringen. "Für diese Zeit sind Weimar und Jena unglaublich wichtig gewesen und viel Material befindet sich vor Ort, das noch lange nicht ausgeforscht ist."
Johannes Grave studierte Kunstgeschichte, mittellateinische Philologie und mittelalterliche Geschichte an der Universität Freiburg/Brsg. Nach der Promotion an der Universität Jena über Goethes graphische Sammlung folgten Stationen am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris und der Universität Basel, wo er sich im Jahr 2012 habilitierte. Bevor er nach Jena kam, verbrachte Grave sieben Jahre in Bielefeld, wo er als Professor für Historische Bildwissenschaft an der Universität das Fach Kunstgeschichte mit aufbaute.
(Bayer)
-
Michael Habeck
Michael Habeck
Foto: Michael Szabó/UKJMit hochauflösenden mikroskopischen Methoden und empfindlichsten Messverfahren dringen Lebenswissenschaftler bis auf das Niveau einzelner Moleküle in die Zellen vor, um sich ein Bild von biologischen Strukturen und ihrer Funktion zu machen. Die gewonnenen Bild- und Messdaten sind jedoch meist indirekt, zu unscharf oder schlicht zu wenige, um daraus unmittelbar beispielsweise auf die dreidimensionale Gestalt eines Proteinmoleküls schließen zu können. Dafür bedarf es aufwendiger Algorithmen und Analysetools, die spezifisch für die Problemstellung entwickelt werden müssen.
Als Professor für Mikroskopische Bildanalyse vertritt Michael Habeck seit dem Wintersemester dieses Forschungsgebiet am Universitätsklinikum Jena. Die experimentellen Daten erhebt er nicht selbst, sondern er ist Partner der biomedizinischen Arbeitsgruppen. Sein Arbeitsgerät ist der Hochleistungsrechner. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert die Einrichtung seiner neuen Arbeitsgruppe mit 1,5 Millionen Euro für fünf Jahre.
"Wir entwickeln Berechnungsmethoden, die Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie, der physikalischen Statistik und des maschinellen Lernens verwenden", erklärt Prof. Dr. Michael Habeck. Als Beispiel nennt er die Strukturaufklärung von Proteinfasern auf der Oberfläche von Bakterien, die das Anheften an Wirtszellen bei Harnwegsinfekten ermöglichen. Mit verschiedenen resonanzspektroskopischen und elektronenmikroskopischen Messungen rückten Wissenschaftler den Eiweißfädchen zu Leibe. Michael Habeck führte die Daten in einem iterativen Rechenalgorithmus zusammen, der schließlich eine detaillierte Beschreibung der Fasergestalt erlaubte. "Das Prinzip konnten wir auch schon für andere Analysemethoden wie die Röntgenkristallografie oder Kryo-Elektronenmikroskopie anwenden und möchten es für weitere Mess- und Bilddaten erweitern", so Habeck.
Nach seinem Physikstudium in Siegen und Heidelberg arbeitete Michael Habeck am European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg und am Institut Pasteur in Paris. Er wurde in der Biophysik an der Universität Regensburg promoviert und forschte anschließend an Max-Planck-Instituten in Tübingen. Mit Förderung der DFG gründete er dort eine Emmy-Noether-Arbeitsgruppe, mit der er an die Universität Göttingen wechselte. Zuletzt leitete er eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen.
In Jena möchte Professor Habeck die Entwicklung neuer Mikroskopietechniken durch innovative Tools zur Bildanalyse ergänzen. In der Jenaer Forschungslandschaft mit ihren Stärken in den Lebenswissenschaften, der Optik und Photonik sowie im wissenschaftlichen Rechnen sieht er dafür beste Bedingungen. "Die spezialisierte Arbeitsgruppe von Professor Habeck, die wir dank der Unterstützung der Carl-Zeiss-Stiftung einrichten können, verbindet die Lebenswissenschaften noch stärker mit den mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern. Mit Methodenkursen und Seminaren für Studierende und Promovierende wird sie auch ihr Lehrangebt interdisziplinär gestalten", betont Prof. Dr. Andreas Hochhaus, Prodekan für Forschung an der Medizinischen Fakultät, die die Finanzierung nach der fünfjährigen Förderung übernimmt.
vdG
-
Christian Jogler
Christian Jogler
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Wenn Christian Jogler sich einem neuen Forschungsobjekt nähert, dann tauscht er für gewöhnlich den Laborkittel gegen einen Neoprenanzug und taucht ab. Der 42-jährige Mikrobiologe ist spezialisiert auf im Wasser lebende Bakterien, sogenannte Planctomyceten. Diese Mikroorganismen spürt Jogler in Meeren, Ozeanen oder Binnengewässern auf. Künftig wird er für seine Streifzüge zu Korallenriffen, Tangwäldern oder Süßwasserschwammkolonien vom thüringischen Jena aus starten: Der wasseraffine Forscher ist in diesem Wintersemester von der Radboud University Nijmegen (Niederlande) an die Friedrich-Schiller-Universität gewechselt und hat hier die neue Professur für Mikrobielle Interaktionen übernommen.
Obwohl Jena ein paar Hundert Kilometer vom nächsten Küstenstreifen entfernt liegt, findet Christian Jogler an der Friedrich-Schiller-Universität ein für seine Forschung perfektes Umfeld. "Was die Mikrobiologie in Jena auszeichnet, sind ihre Vielfalt und die enge Vernetzung in andere Disziplinen", unterstreicht er. Die Mikrobiologie ist eine zentrale Säule des Forschungsprofils der Universität. "Vor allem die Kombination der Profillinien Light und Life passt für mich und mein Team optimal." Im Uni-Institut für Mikrobiologie, "einem der deutschlandweit größten und renommiertesten überhaupt", aber auch im Exzellenzcluster "Balance of the Microverse"Externer Link und außeruniversitären Jenaer Forschungseinrichtungen findet Jogler zahlreiche neue Kooperationspartner und Anknüpfungspunkte für neue Projekte.
So etwa bei seinen Forschungen zu neuen Naturstoffen, wie Antibiotika. "Neue Antibiotika werden dringend gebraucht", weiß Christian Jogler und erklärt: "Fast drei Viertel aller heute klinisch relevanten Antibiotika sind von Bakterien gebildete Naturstoffe." Christian Jogler und sein Team haben sich unter anderem deshalb auf die Planctomyceten spezialisiert, weil sie in ihnen zahlreiche bislang unbekannte Wirkstoffe vermuten. Viele der heute bekannten Planctomyceten leben im Wasser: Auf Pflanzen, Steinen oder Schwämmen bilden sie in Gemeinschaft mit anderen Mikroorganismen Biofilme. Was diese Bakterien für die Wissenschaft so interessant macht, ist, dass sie große, komplexe Genome und außergewöhnliche Stoffwechsel aufweisen. "Das sind genau die Voraussetzungen, die Mikroorganismen erfüllen, die Naturstoffe wie Antibiotika produzieren", sagt Jogler.
Auch wenn die Entdeckung neuer Wirkstoffe für die Medizin ein immenses Anwendungspotenzial ist, Christian Jogler sieht sich in erster Linie als Grundlagenforscher. "Mich interessieren vor allem umweltmikrobiologische Aspekte der Planctomyceten. Wo kommen sie vor? Mit wem interagieren sie?" Aber auch die Zellbiologie der Planctomyceten sei ein Fokus seiner Forschung. Um die inneren Strukturen und Zellprozesse der Bakterien zu untersuchen, nutzt Prof. Jogler hochauflösende mikroskopische und modernste Gensequenzierungsmethoden — und bereichert damit die Jenaer Expertise in diesem Bereich. Unter anderem möchte er die "Stochastic Optical Reconstruction Microscopy" — kurz STORM — in seinem neuen Jenaer Institut nutzen. Dieses hochauflösende Mikroskopieverfahren hat er bereits während seiner Zeit als Postdoc an der Harvard Medical School in Boston kennengelernt, wo es 2006 entwickelt wurde. Jogler war 2010 bis 2012 mit einem Marie-Curie-Stipendium der Europäischen Kommission in Boston.
Weitere Stationen seines Karriereweges waren die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) in Braunschweig von 2012-2016, die Ludwig-Maximilians-Universität München (2007-2009) und das Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen (2005-2006). Christian Jogler hat an der Universität Kaiserslautern Biologie studiert und wurde 2005 an der Ruhr-Universität Bochum promoviert.
(Schönfelder)
-
Robert Kretschmer
Robert Kretschmer
Foto: Jan-Peter Kasper (Universität Jena)Robert Kretschmer steht auf und öffnet eine Wasserflasche. „Wir benutzen dafür beide Hände anstatt einer, weil es besser geht“, erklärt der Chemiker von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Das Gleiche versuche ich auch in meiner Forschung anzuwenden. Die meisten Katalysator-Moleküle haben nämlich nur ein aktives Zentrum. Wenn man aber zwei verwendet, können sie zusammenarbeiten.“ Unter welchen Umständen das gelingen kann, das ist eine der Fragen, die der neue Juniorprofessor für Anorganische Chemie der Katalyse seit diesem Semester in Jena erforscht.
Ein Ziel des 35-jährigen Wissenschaftlers ist es, nachhaltigere und ungiftigere Methoden zu entwickeln, mit denen verschiedene chemische Grundstoffe hergestellt werden können. Wo oftmals giftige Schwermetalle zum Einsatz kommen, wie Rhodium oder Platin, wählt Robert Kretschmer deutlich harmlosere Elemente wie Aluminium, Silizium oder Magnesium. „Das ist zum Beispiel ein Vorteil, wenn Kunststoffe damit hergestellt werden“, erklärt Kretschmer. „Denn die Katalysator-Moleküle werden dabei in dem Kunststoffmaterial eingeschlossen.“
Bei seinen „zweihändigen“ Systemen gibt es allerdings viele Stellschrauben, die untersucht und aufeinander abgestimmt werden müssen. Damit die beiden „Hände“ zusammenwirken können, muss der Abstand zwischen ihnen stimmen – aber auch der Winkel oder die Orientierung zueinander. „Wir konnten bisher zeigen, dass das Konzept stimmt. Aber wir wissen noch nicht genau, was dabei geschieht.“ Dass er das in den nächsten Jahren in Jena herausfinden wird, davon ist Kretschmer überzeugt. Denn er kennt die Universität bereits.
Nach mehrjähriger Erfahrung als Chemielaborant studierte er von 2007 bis 2010 Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität. Nach seiner Promotion an der TU Berlin 2012 forschte er für ein Jahr jenseits des Atlantiks in San Diego, bevor er ab 2015 Nachwuchsgruppenleiter an der Universität Regensburg wurde. „Ich hätte dort noch einige Jahre bleiben können,“ sagt Kretschmer. „Aber die Jenaer Juniorprofessur mit Tenure Track hat mich aufgrund der vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten einfach gereizt. Die Chemie ist hier sehr stark aufgestellt.“ Er ergänzt: „Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte, kurze Wege und die Gruppen sind hochmotiviert. Auch meine Teammitglieder, die mit mir aus Regensburg nach Jena gekommen sind, sind begeistert.“
Engagiert ist er aber nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre. Seit einigen Jahren entwickelt er gemeinsam mit Spieleentwicklern und Kolleginnen und Kollegen der „Jungen Akademie“ eine App für Smartphones und Tablets. Diese soll wissenschaftliches Schreiben spielerisch an Studierende vermitteln. „Die App erklärt, was bei wissenschaftlichen Texten beachtet werden muss und zeigt dann Texte und Abbildungen. Dort müssen Fehler entdeckt werden.“ Wenn sie fertig ist, will Prof. Kretschmer die App zum Beispiel zusätzlich in Seminaren einsetzen.
-
Christian Kreuder-Sonnen
Mehr erfahrenChristian Kreuder-Sonnen
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Denomination: Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Internationale Organisationen
zuvor: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
-
Kai Lawonn
Kai Lawonn
Foto: privat/LawonnEr ist undotiert, gehört aber in der Visualisierungsforschung zu den wichtigen Preisen: der EuroVis Young Researcher Award. In diesem Jahr erhält Prof. Dr. Kai Lawonn von der Universität Jena die Auszeichnung, mit der ihm bestätigt wird, dass er durch herausragende wissenschaftliche Beiträge zur Visualisierungsforschung in Europa beigetragen hat. Der Preis wird ihm am 25. Mai auf der Fachkonferenz „Eurographics & Eurovis 2020“ übergeben, die angesichts der Corona-Pandemie virtuell stattfindet. „Ich hoffe, dass der Preis dazu beitragen wird, mehr Aufmerksamkeit auf den Bereich der Visualisierung zu lenken“, sagt Lawonn. „Er soll mehr junge Menschen dazu ermutigen, Informatik zu studieren und sich an diesem aktiven Forschungsfeld zu beteiligen.“
Kai Lawonn ist seit kurzem Juniorprofessor für Visualisierung und explorative Datenanalyse der Universität Jena. Der 34-jährige Informatiker arbeitet daran, riesige Datenmengen mit Hilfe von Algorithmen in leicht begreifbare Modelle zu überführen. Die von Prof. Lawonn entwickelten Programme kommen u. a. in der Medizin zum Einsatz. So entwarf er eine verbesserte Darstellung cerebraler Aneurysmen. Das sind ballonartige Ausbeulungen an Gefäßen im Kopf, bei denen Blut gegen die Gefäßwand drückt und die zum Tod führen können, wenn sie platzen: „Die Ursachen für das Platzen sind zwar noch nicht restlos geklärt, aber man geht davon aus, dass die Größe, die Morphologie und der Blutfluss der Gefäße entscheidend sind“, erläutert Lawonn. Jedoch können herkömmliche Bildgebungsverfahren, etwa das MRT, diese Faktoren nicht gut abbilden. „Hier kommen ich und mein Team ins Spiel: Wir erzeugen am Computer ein 3D-Modell, dem Ärzte schnell die wichtigsten Informationen entnehmen können.“
Auch in Jena befasst sich Lawonn hauptsächlich mit der medizinischen Visualisierung, die Ärzten bei der Diagnose oder der Operationsplanung helfen soll. Dafür arbeitet er eng mit dem Universitätsklinikum und anderen Universitäten zusammen. Mit einem neuen Programm will das Forschungsteam zuverlässig die Wahrscheinlichkeit bestimmen, ob ein Patient einen Schlaganfall erleidet oder nicht. „Auch dabei berücksichtigen wir viele verschiedene Faktoren wie Patienteninformationen, Gefäßmorphologie und Blutflusseigenschaften, deren Zusammenspiel zu einer verbesserten Voraussage führen soll“, so Lawonn.
Lawonns Expertise ist aber auch in ganz anderen Gebieten gefragt. So kam seine Software im Magdeburger Dom zum Einsatz, um dort ein über 800 Jahre altes Bildnis des damaligen Königs Otto wieder sichtbar zu machen. Dazu nahm er den verfallenen Putz zunächst mit einer stereoskopischen Kamera auf und berechnete dann mit Algorithmen ein topologisches Modell. Durch die räumliche Darstellung ließen sich die Putzritzungen des Kunstwerks schließlich rekonstruieren. „Es ist vor allem diese Zusammenarbeit mit verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die mir an meinem Beruf so viel Spaß bereitet“, sagt Lawonn. „So lerne ich andere Perspektiven kennen und werde stets mit abwechslungsreichen Forschungsfragen konfrontiert.“
Kai Lawonn studierte Mathematik in seiner Heimatstadt Berlin. Danach wagte er den Sprung in die verwandte Disziplin der Informatik, obwohl er zuvor wenig Programmiererfahrung besaß. Das Experiment gelang: In Magdeburg promovierte er zum Thema „Illustrative Visualisierung medizinischer Datensätze“. Im Anschluss begann er seine Juniorprofessur an der Universität Koblenz-Landau und habilitierte parallel dazu – das alles in beeindruckender Geschwindigkeit. In Jena will er seine Leidenschaft für die Informatik auch in die universitäre Lehre einbringen. „Für meine Studierenden werde ich immer ein offenes Ohr haben“, verspricht Lawonn. „Außerdem will ich mich dafür einsetzen, dass sie das Gelernte direkt anwenden können.“
(T. Bayer)
-
Viktor Leis
Viktor Leis
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Im digitalen Zeitalter gewinnt die computergestützte Speicherung von Daten immer mehr an Bedeutung. Es genügt schon, mit dem Smartphone von A nach B zu navigieren oder online Geld zu überweisen. Datenbanksysteme sorgen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer aus einer Vielzahl an gespeicherten Daten die richtigen Informationen erhalten. Diese Software basiert in der Regel auf einer komplexen Programmierung und wird nicht nur von Technologiekonzernen weiterentwickelt, sondern auch von der Wissenschaft untersucht. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena forscht seit Beginn des Sommersemesters der Informatiker Viktor Leis zu diesem Thema. Der 35-Jährige ist zum Professor für Datenbanken und Informationssysteme ernannt worden.
„Als praktischer Informatiker programmiere ich selbst Softwaresysteme und setze mich dann mit Problemen auseinander, die sich im Lauf der Entwicklung ergeben“, erklärt Leis. Auf diese Weise nähert er sich dem Ziel seiner Forschung: der Fertigstellung eines Datenbanksystems für sehr große Datenmengen ab mehreren Terabyte. Zur Veranschaulichung: Ein Terabyte bietet genügend Platz für die Speicherung von circa 300.000 Bildern. Die Software könnte also in Bereichen zum Einsatz kommen, in denen sich über Jahre hinweg sehr viele Daten ansammeln – zum Beispiel bei wissenschaftlichen Studien oder bei der Organisation von Arbeitsabläufen in großen Betrieben.
Der Knackpunkt beim Programmieren einer solchen Software liegt für Leis in der Abstimmung mit der Hardware. „Theoretisch können Computer mit moderner Hardware sehr schnell sein und in einer Sekunde auf hunderte Millionen Elemente zugreifen“, sagt Leis dazu. „Doch in der Praxis wird diese Geschwindigkeit nicht erreicht, weil veraltete Programme zum Einsatz kommen, die aus den technologischen Neuheiten der letzten Jahre keinen Nutzen ziehen.“ Viktor Leis möchte dies ändern, indem er bestimmte Komponenten wie Mehrkernprozessoren oder Speicher auf Basis von Halbleitertechnologie für die Architektur seiner Software berücksichtigt.
An der Entwicklung einer produktreifen Datenbank-Software war Leis schon einmal beteiligt. Nach Abschluss seines Diplomstudiums an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg ging er an die Technische Universität München und war dort Mitbegründer des Start-Ups „HyPer“, in dem Wissenschaftler eine Software zur analytischen Abfrage von Daten programmierten. Das Gründungsprojekt war erfolgreich und wurde 2016 von Tableau gekauft, einem US-amerikanischen Anbieter von Programmen zur Datenvisualisierung.
Trotz dieses wirtschaftlichen Erfolgs stand für Viktor Leis die ganze Zeit über fest, dass er in der Wissenschaft bleiben möchte. „Dort entstehen einfach die besseren Softwarekonzepte, weil im Gegensatz zur Industrie langfristig gedacht wird“, befindet der Landshuter, der in seiner Freizeit Bücher zu politischen und historischen Themen liest. „Zudem kann man sich sein Thema frei aussuchen und sich innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft austauschen.“
Leis ist überzeugt, dass er von diesem „tollen Mix“ auch am Institut für Informatik der Friedrich-Schiller-Universität Jena profitieren wird. Nach den ersten Wochen in Jena habe er jedenfalls einen positiven Eindruck von seinem neuen Arbeitsumfeld. „Außerdem gefällt mir das Lebensgefühl in der Stadt, das von den vielen Studierenden der Universität geprägt ist.“
(Bay)
-
Florian Meier
Florian Meier
Foto: Michael Szabó/UKJDie Serviceingenieure sind eben erst fertig geworden mit dem Aufbau eines Hochleistungsmassenspektrometers im Forschungszentrum des Klinikums in Lobeda. Diese Analysetechnik der neuesten Generation ist das Arbeitsgerät von Florian Meier, der die neue Juniorprofessur für funktionelle Proteomanalyse an der Medizinischen Fakultät Jena innehat. Der Biochemiker etabliert mit seiner Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum eine Methodik der Proteomanalyse, die in einer einzelnen Probe mehrere tausend Proteine gleichzeitig erfassen kann. Zu dem Verfahren gehören eine hochspezialisierte Probenvorbereitung, die die Eiweißmoleküle erst für die massenspektrometrische Messung verfügbar macht, und eine aufwändige bioinformatische Auswertung.
„Während das Genom quasi das Rezeptbuch für die Proteine darstellt, erfassen wir mit der Proteomanalyse, welche Enzyme, Signaleiweiße und Strukturproteine wirklich gekocht wurden und wie viele davon“, erklärt Professor Meier. „Das erlaubt Proteomprofile von Zellen oder Gewebeproben zu vergleichen, Signalwege zu analysieren und ganze Netzwerke von Protein-Protein-Wechselwirkungen aufzuklären. So kann ein detailliertes Verständnis von Gesundheit und Krankheit auf der molekularen Ebene entstehen.“ Als Beispiel nennt Florian Meier die Suche nach potentiellen Biomarkern im Blut oder die Erforschung von Resistenzen in der Krebstherapie.
Der gebürtige Saarländer hat an der Universität Saarbrücken Chemie studiert und bereits während seines Masterstudiums Forschungsaufenthalte in Kanada und den USA absolviert. Anschließend forschte er am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried und promovierte mit seiner Arbeit zur massenspektroskopischen Proteomanalyse an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Als Doktorand durfte er an der Nobelpreisträgertragung in Lindau teilnehmen und wurde unter anderem mit dem Wolfgang-Paul-Studienpreis der Deutschen Gesellschaft für Massenspektrometrie ausgezeichnet. Zuletzt arbeitete Florian Meier als PostDoc in Martinsried und leitete dort die Technologieentwicklung in der Abteilung Proteomics und Signaltransduktion.
Mit seiner neuen Arbeitsgruppe am UKJ wird Florian Meier seine methodische Expertise in vielfältige Kooperationen einbringen. Beispielsweise will er mit Forscherteams in der Onkologie das Proteom von Tumor- und Leukämiezellen untersuchen, um die Heterogenität von Tumorzellen oder therapieresistente Leukämieformen besser zu verstehen. Entsprechend der jeweiligen biomedizinischen Fragestellungen entwickelt er die Methodik weiter und baut die funktionelle Proteomanalyse als Technologieplattform für translationale Forschung am UKJ auf.
(vdG)
-
Sander Münster
Sander Münster
Foto: privat/Michael Kretzschmar, 2019Wo einst eine mächtige Eiche Schatten spendete und Passanten zum Verweilen einlud, stehen heute ein Einkaufszentrum und Thüringens höchstes Bürogebäude. Die engen Gassen des mittelalterlichen Stadtkerns, in der Nähe der Stadtmauer mit ihren Wehrgängen und dem einzigen erhaltenen Stadttor, sind einer Freifläche mit Parkplatz gewichen und moderne Betonarchitektur prägt die Straßenzüge rund um den historischen Stadtkern.
So wie in Jena, der Stadt von der hier die Rede ist, wandeln Städte ihr Aussehen im Laufe der Zeit überall auf der Welt. Aus der Gegenwart dennoch einen lebendigen Eindruck der jeweiligen Stadtgeschichte zu vermitteln, der es ermöglicht, mit allen Sinnen in die Vergangenheit einzutauchen, das ist das Ziel von Junior-Prof. Dr. Sander Münster. Der 39-jährige Historiker ist vor kurzem von der TU Dresden an die Friedrich-Schiller-Universität Jena gewechselt und hat hier die neu eingerichtete Professur für Digital Humanities mit Schwerpunkt Bild- und Objektdaten übernommen.
In einem ersten kleinen Lehrprojekt lässt Sander Münster derzeit den historischen Eichplatz im Zentrum Jenas für einen virtuellen Rundgang wieder auferstehen. Der Einsatz von Visualisierungstechnologien zur Erforschung und Vermittlung von Geschichte ist ein Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit. Und das nicht nur für das vergleichsweise kleine Jena. In einem europäischen Großprojekt wollen Münster und ein Konsortium von mehreren tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern etwa 2.000 Jahre europäische Geschichte lebendig machen. Time MachineExterner Link – die Zeitmaschine – heißt der wissenschaftliche Verein der zur Umsetzung dieser Vision gegründet wurde und in dem knapp 700 Institutionen aus 34 Ländern Mitglied sind. Sander Münster ist Generalsekretär dieses Vereins und leitet die deutsche Koordinierungsstelle.
„In diesem Projekt geht es darum, mittels großskaliger schneller Digitalisierungsverfahren, historische Wissensbestände zu erfassen und zu erschließen, um sie für Nutzer vierdimensional – also räumlich und zeitlich – erlebbar zu machen und damit im Wortsinne Zeitreisen zu ermöglichen“, erläutert Sander Münster. Das auf zehn Jahre angelegte Forschungsprojekt ziele darauf ab, Big Data der Geschichte zu generieren und die soziale, kulturelle und geographische Entwicklung Europas seit der Antike abzubilden. Jeder Interessierte kann sich damit per Internetbrowser in die Vergangenheit quer über den Kontinent begeben – von Amsterdam über Budapest bis Venedig und Jerusalem.
Vor seinem Wechsel an die Universität Jena war Sander Münster in Dresden tätig. An der Technischen Universität hat er Wirtschaft, Geschichte und Pädagogik studiert, bevor er im Bereich Bildungstechnologie promoviert wurde. Seine Doktorarbeit zu virtuellen geschichtswissenschaftlichen 3D-Rekonstruktionen hat er 2014 beendet. Seit 2018 läuft an der Universität Regensburg sein Habilitationsvorhaben zum Thema „Digital 3D technologies for humanities research and education“. Neben seiner akademischen Laufbahn betreibt er seit 15 Jahren auch eine eigene kleine Firma, die wissenschaftliche Visualisierungen und 3D-Simulationen anbietet.
Nach Jena zog ihn unter anderem die starke geisteswissenschaftliche Forschung hier an der Universität, „aus der sich die Digital Humanities speisen.“ Außerdem reizt Münster die Perspektive, hier gemeinsam mit einer weiteren neuen Professur zu Digital Humanities einen größeren Forschungsschwerpunkt für die Universität aufzubauen.
(U. Schönfelder)
-
Hyhen Nguyen
Denomination: Finanzmarktökonomik
zuvor: Universität Nottingham (UK)
-
Manuela Nowotny
Prof. Dr. Manuela Nowotny
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Laubheuschrecken hören mit den Vorderbeinen. Genauer gesagt: Die Ohren der Tiere befinden sich unterhalb des „Knies“ in den Vorderbeinen. Dennoch hören die Heuschrecken nach dem gleichen mechanischen Prinzip wie Menschen. „Die Aufnahme des Schalls und das Weiterleiten zur Reizverarbeitung sind bei den Heuschrecken nicht viel anders als bei uns“, sagt Dr. Manuela Nowotny. Die Jenenserin hat seit kurzem die Professur für Tierphysiologie an der Universität Jena inne.
Aktuell untersucht Manuela Nowotny Laubheuschrecken der Arten Mecopoda elongata, Ancylecha fenestrata und Stilpnochlora couloniana. Insgesamt gibt es ca. 7.000 Arten. Die Tiere stammen ursprünglich aus Südostasien und Mittelamerika, es sind Regenwaldbewohner. Für die Forschung sind sie geeignet, weil ihr Hörapparat zwar nach den gleichen mechanischen Prinzipien wie der menschliche arbeitet, dabei aber viel einfacher strukturiert ist. „Eine der Arten hat exakt 45 Sinneszellen, beim Menschen sind es mehrere tausend“, sagt Nowotny. Bei einer anderen Art haben die Männchen 110, die Weibchen nur 80 Sinneszellen. Das Mehr an Zellen bei den Männchen dient zum Empfang und Verarbeitung jener Frequenzen, mit denen die Weibchen singen. Wobei Singen ein wenig übertrieben ist: Die Töne entstehen, indem die Tiere ihre Flügel aneinander reiben. Üblicherweise stimmen die Tiere ihren Gesang zu festen Zeiten an. Eine der untersuchten Arten beginnt um 16 Uhr: das ist die Zeit, bei der im Regenwald die Nacht hereinbricht. Andere Heuschrecken singen um Mitternacht. Manuela Nowotny sagt, dass die Weibchen dieser Art zudem nur sehr kurz zu vernehmen sind. Angesichts der Geräuschkulisse im nächtlichen Regenwald vollbringen die Männchen also wahre Höchstleistungen. Ihr Fortpflanzungserfolg ist offensichtlich an gutes Hören gekoppelt.
In Jena möchte Manuela Nowotny eng mit dem Universitätsklinikum zusammenarbeiten. Ein Ziel der Kooperation ist es, einen objektiven Test für Tinnitus zu entwickeln. Für Manuela Nowotny schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Denn für ihre Promotion 2005 in Tübingen hat sie die Innenohrmechanik von Säugetieren am Beispiel des Meerschweinchens untersucht.
Studiert hat die 43-jährige Biologin in Jena, mit Studienaufenthalten in Graz und Berlin. Dann ging sie 2001 nach Tübingen, wo sie in einer Forschungsabteilung der universitären HNO-Klinik arbeitete und an der Eberhard Karls Universität Tübingen 2005 promovierte. Nächste Station war die Goethe-Universität in Frankfurt/M., hier folgte 2015 die Habilitation über biomechanische und physiologische Mechanismen im Innenohr. Forschungsaufenthalte führten sie u. a. nach Cambridge in England und an die Columbia University in New York. „In Cambridge standen Wissensaustausch und Methodenlehre auf dem Programm, in New York habe ich viel über Flüssigkeitsdynamik im Innenohr gelernt“, sagt Manuela Nowotny.Bei der Forschung an Säugetieren dienen Mäuse und Mongolische Wüstenrennmäuse als Modellorganismen. Immer wieder wird überprüft, ob sich die Befunde ihres Hörapparates auf das komplexe Hörsystem des Menschen übertragen lassen. Dabei müssen Manuela Nowotny und ihr Team Methoden entwickeln, mit denen sich die Tiere „befragen“ lassen, was sie hören. So gibt es beispielsweise einen Test, der den Forschern anzeigt, ob die Tiere tatsächlich einen Tinnitus entwickelt haben. Den Tieren wird ein variabler Dauerton vorgespielt, dem ein plötzliches lautes Geräusch folgt. „Wenn sie tatsächlich Tinnitus haben, erschrecken sie anders als mit intaktem Gehör“, sagt Manuela Nowotny.
Die Entscheidung, nach Jena zurückzukehren, fiel der Mutter zweier Kinder nicht schwer. „Um zoologisch-evolutionär zu forschen, ist Jena eine ganz besondere Adresse“, sagt Prof. Nowotny. Noch werden ihre Labore eingerichtet, die Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern läuft und ihr Mann und die Kinder ziehen in Kürze an die Saale. Die Laubheuschrecken leben sich bereits in der neuen Umgebung ein.
(Laudien)
-
Kai Papenfort
Kai Papenfort
Foto: privat/PapenfortCholera ist eine lebensbedrohende Erkrankung. Sie verursacht Bauchkrämpfe, Erbrechen und heftigen Durchfall. Auslöser ist das Bakterium Vibrio cholerae, das meist über kontaminiertes Trinkwasser in den Darm eines Menschen gelangt. Allerdings führt nicht jede Besiedelung mit V. cholerae automatisch dazu, dass ein Mensch an Cholera erkrankt. Das passiert nur, wenn sich eine hinreichend große Menge an Choleraerregern im Darm zu einem dichten Biofilm zusammengefunden hat. Dann produzieren die Erreger auf einen Schlag das giftige Choleratoxin und die Krankheit nimmt ihren Lauf.
Doch woher wissen die Bakterien, ob sie zahlreich genug sind, um die Immunabwehr des Wirtsorganismus zu überwinden? „Dafür nutzen die Erreger eine Art chemisches Zählwerk“, weiß Prof. Dr. Kai Papenfort von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und erklärt: „Sie produzieren Signalmoleküle und geben diese in ihre Umgebung ab“, so der Mikrobiologe, der in diesem Wintersemester von der Ludwig-Maximilians-Universität München an die Uni Jena gewechselt ist. Da die Bakterien diese Moleküle nicht nur selbst produzieren, sondern über Rezeptoren auch aus der Umgebung wahrnehmen können, erhalten sie so Informationen über die Zelldichte ihrer Population. Und je nach Zelldichte regulieren die Mikroben ihr Verhalten. Diese Form der chemischen Kommunikation unter Einzellern bezeichnen die Forscher als „Quorum Sensing“.
Neues Konzept von AntibiotikaIn seinem neuen Labor auf dem Jenaer Beutenberg-Campus versucht Prof. Papenfort mit seinem Team diese Art des chemischen Small Talks der Cholerabakterien zu entschlüsseln.
"Wenn wir die Sprache der Mikroorganismen sprechen, könnten wir zum Beispiel verhindern, dass die Cholerabakterien ihr Virulenzprogramm starten, weil wir ihnen vormachen, dass sie noch nicht genügend Artgenossen um sich versammelt haben“, sagt der 38-Jährige. Wer die Regeln des „Quorum Sensing“ beherrscht, so ist Papenfort überzeugt, hat die Möglichkeit, ein vollkommen neues Konzept von Antibiotika zu entwickeln. Und das nicht nur gegen Cholera. Auch Salmonellen, Staphylokokken oder Pseudomonaden ließen sich durch „chemisches Zureden“ davon abbringen, Krankheiten auszulösen.
Das Thema „Quorum Sensing“ hat Kai Papenfort aus den USA mitgebracht, wo er von 2012 bis 2015 an der Universität Princeton im Team von Bonnie Bassler gearbeitet hat, „einer Pionierin auf diesem Gebiet“. Und auch hier in Jena hat er mit seinen grundlegenden Forschungsarbeiten zur mikrobiellen Kommunikation bereits zahlreiche Anknüpfungspunkte gefunden. „Die Universität Jena ist mit ihrem Microverse-Exzellenzcluster dafür bestens aufgestellt“, betont er. Auch zu Arbeitsgruppen des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie, das sich in direkter Nachbarschaft am Beutenberg befindet, hat Papenfort bereits gute wissenschaftliche Kontakte. Ausgezeichnete Voraussetzungen also für intensiven Austausch – und nicht nur für die mikrobielle Kommunikation.
Überzeugt, den Ruf der Friedrich-Schiller-Universität anzunehmen, hat den jungen Familienvater neben der starken mikrobiologischen Forschung in Jena auch das familienfreundliche Umfeld in Stadt und Universität. „Für mich und meine Partnerin, die auch als Wissenschaftlerin arbeitet und eine eigene Forschungsgruppe leitet, war es ganz wichtig, dass wir für unsere Tochter hier eine gute Kinderbetreuung finden“, sagt Papenfort. Die Dreijährige besucht jetzt die Kita auf dem Beutenberg, nur einen Steinwurf vom Institut entfernt.
Kai Papenfort hat in Marburg Biologie studiert und sich bereits in seiner Diplomarbeit auf Mikrobiologie und Molekularbiologie fokussiert. Nach dem Studium ging er ans Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin, wo er sich in das damals ganz neue Forschungsfeld der regulatorischen RNA-Moleküle einarbeitete. Bis heute sind diese, die Genaktivität von Bakterien kontrollierenden, Moleküle ein weiterer Forschungsschwerpunkt von ihm – nicht zuletzt, weil sie auch beim „Quorum Sensing“ eine Rolle spielen. 2010 wurde er an der Humboldt-Universität Berlin promoviert und wechselte anschließend als Postdoc an die Universität Würzburg und 2012 mit einem Stipendium des Human Frontiers Science Programms nach Princeton. Im Jahr 2015 kehrte er nach Deutschland zurück, zuerst nach München und jetzt nach Jena.
Für seine Forschungsarbeiten ist Prof. Papenfort bereits mit zahlreichen Förderungen und Preisen gewürdigt worden, u. a. mit einem Postdoktorandenpreis der Robert-Koch-Stiftung (2014), einem Starting Grant des European Research Councils (2017) und als Scholar der Vallee Foundation (2019).
(Schönfelder)
-
Simon Runkel
Simon Runkel
Foto: privat/RunkelSeit einiger Zeit duftet es in den Innenstädten wieder nach Glühwein, gebrannten Mandeln und anderen Leckereien. Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet und locken zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die sich dicht an dicht um die Buden drängen. Für die Veranstalter der Märkte sind die Menschenmengen, die dabei auf engstem Raum zusammenkommen, eine echte Herausforderung. "Weihnachtsmärkte brauchen ein gutes Crowd Management, das die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Anwesenden gewährleistet", sagt Prof. Dr. Simon Runkel. Der 34-Jährige ist neuer Professor für Sozialgeographie an der Universität Jena; er forscht zur Räumlichkeit sozialer Kollektive und Gemeinschaften.
Unter dem Begriff Crowd Management versteht Runkel alle Maßnahmen zur räumlichen Organisation großer Menschenmengen - nicht nur bei Weihnachtsmärkten, sondern auch bei anderen Großereignissen wie Musikfestivals oder Fußballspielen. Wer solche Veranstaltungen plant, muss viele wichtige Entscheidungen treffen: Wie viel Sicherheitspersonal kommt zum Einsatz? Wo befinden sich die Ein- und Ausgänge? Und wie kommunizieren die Veranstalter im Notfall mit der Menge, durch Schilder oder mithilfe von Lautsprechern? Allgemeingültige Antworten gibt es nicht: "Wie all diese Maßnahmen umgesetzt werden, hängt von vielen Faktoren ab, wie der Art des Events, der Besucheranzahl oder der Lokalität", erläutert Runkel. "Es macht einen großen Unterschied, ob 5.000 Menschen zu einer Demonstration in eine Großstadt oder in eine Kleinstadt kommen."
Als Sozialgeograph interessiert sich Runkel aber nicht nur für die organisatorischen Details, sondern auch für die veränderten Gefühlslagen der Besucherinnen und Besucher. "Die Wahrnehmung des Einzelnen in der Masse spielt eine große Rolle", erklärt der Experte für Risiko- und Sicherheitsforschung. "Unterschieden werden muss zwischen einer objektiven Sicherheitslage und der gefühlten Sicherheit, die als gemeinsam geteilte Atmosphäre erlebt wird."
In einer gemeinsamen Studie mit Forschern aus Großbritannien und Frankreich stellte Prof. Runkel fest, dass in ganz Europa - bedingt durch Terroranschläge der vergangenen Jahre - immer komplexere Sicherheitstechnologien im öffentlichen Raum zum Einsatz kommen. Dazu zählt beispielsweise die Crowd-Sensing-Technologie, die das Verhalten einer Menschenmenge mithilfe von Daten überwacht, die von Smartphones versendet werden. Zudem fanden die Forscher heraus, dass immer mehr Menschen das bewusste Bad in der Menge meiden und vielleicht gerade wegen der zunehmenden Sicherheitsmaßnahmen Angststörungen entwickeln. "Im europäischen Ausland werden immer häufiger versteckte oder spielerische Lösungen eingesetzt, um die Wohlfühlqualität in Städten zu wahren", so Runkel. "Es besteht allerdings die Gefahr, dass mit stärkeren Sicherheitsvorkehrungen auch Freiheiten eingeschränkt werden."
Simon Runkel, der aus dem nordrhein-westfälischen Siegen stammt, studierte Geographie, Friedens- und Konfliktforschung, Psychologie und Kunstgeschichte an den Universitäten Marburg, Bonn und der University of California in Los Angeles. Für eine Arbeit zum Thema Crowd Management erhielt er im Jahr 2015 den Doktorgrad. Parallel zu seiner Promotion sammelte er praktische Erfahrungen: Er arbeitete für ein privatwirtschaftliches Ausbildungs- und Beratungsunternehmen, das spezielle Trainings für Veranstaltungssicherheit anbietet. Bevor er nach Jena kam, forschte und lehrte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Heidelberg, Bonn und Siegen. In Jena fühlt sich der junge Geographie-Professor bereits heimisch. "Man merkt ganz deutlich, dass sich hier etwas bewegt", findet Runkel. "Besonders gefällt mir, dass sich so viele junge Menschen politisch engagieren."
-
Thomas Scharinger
Mehr erfahrenExterner LinkThomas Scharinger
Foto: privat/Scharinger"Dass das Englische heute wohl als die bedeutendste internationale Verkehrs- und Kultursprache zu betrachten ist, weiß jeder. In der Vergangenheit spielten die großen romanischen Sprachen aber nicht selten eine weitaus wichtigere Rolle als das Englische", erklärt Prof. Dr. Thomas Scharinger. Der 37-Jährige ist neuer Professor für Romanische Sprachwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und hat sich mit der Verbreitung des Französischen und Italienischen außerhalb ihres angestammten Territoriums intensiv beschäftigt.
Prof. Scharinger ist von der Ludwig-Maximilians-Universität München nach Jena gewechselt. In einem aktuellen Forschungsprojekt will er herausfinden, welchen Stellenwert das Französische im 18. Jahrhundert am Weimarer Hof hatte, wo sich auch Geistesgrößen wie Schiller, Goethe und Wieland aufhielten. Wie gestaltete sich der damalige Sprachunterricht, welche literarischen Klassiker wurden als Fremdsprachentexte rezipiert und in welchen Bereichen fand das Französische als gesprochene und geschriebene Sprache tatsächlich Verwendung?
Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen stöbert Scharinger in den umfangreichen Textbeständen, die aus dieser Zeit erhalten sind. "Es existiert noch immer jede Menge unerforschtes Material", sagt der aus Mittelfranken stammende Experte für Sprachgeschichte. Erstaunlich sei vor allem, dass über die Rolle des Italienischen in Weimar schon viel mehr bekannt ist als über jene des Französischen. Immerhin habe das Französische damals in ganz Europa als galante Hofsprache schlechthin gegolten, wohingegen das Italienische vor allem im 16. Jahrhundert von Bedeutung war.
Mit der Verbreitung des Italienischen im Europa des 16. Jahrhunderts hat sich Scharinger u. a. in seiner 2018 veröffentlichten Dissertation auseinandergesetzt. Darin kam er zu dem Ergebnis, dass das Italienische nicht nur als Kultursprache - etwa in Form von Belletristik - die Landesgrenzen passierte, sondern auch durch Migration.
Verantwortlich dafür waren neben den vielen Malern, Bildhauern und Architekten, die aufgrund der Ausstrahlungskraft der italienischen Renaissancekultur an Europas Höfe geholt wurden, auch italienische Adlige, die nach ihrer Heirat mit einem ausländischen Fürsten nicht selten von ihrer italienischen Entourage an ihren neuen Herrschaftssitz begleitet wurden. "Die Migranten sorgten für einen regen Austausch und genossen in der Regel ein hohes Prestige", erklärt Scharinger. "So konnten viele italienische Wörter in andere Sprachen Eingang finden." Auch ins Deutsche gelangten Begriffe, die heute noch gebräuchlich sind, wie die finanzsprachlichen Ausdrücke "Konto", "Risiko" und "Bankrott".
Nach Abschluss seines Studiums forschte und lehrte Thomas Scharinger zunächst an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Für seine Promotion ging er an die Ludwig-Maximilians-Universität München, an der er bis 2019 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war, bevor er nun als Juniorprofessor an die Universität Jena wechselte. "Die Atmosphäre hier am Institut ist sehr familiär und mir wurde von Anfang an viel Wertschätzung entgegengebracht", sagt der junge Sprachwissenschaftler über sein neues Umfeld.
(Bayer)
-
Jan Schirawski
Mehr erfahrenExterner LinkJan Schirawski
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Die Sporen des Mais-Kopfbrandpilzes, auch Sporisorium reilianum genannt, können eine schreckliche Wirkung entfalten: Sie befallen ihre Wirtspflanzen Mais und Hirse, indem sie ins Innere der Pflanzenzellen eindringen und dort die Genregulation verändern. Auf diese Weise schalten sie zunächst das Abwehrsystem aus und infizieren die Pflanze dann vollständig. Die feindliche Übernahme bleibt von außen unbemerkt; die befallene Pflanze scheint völlig gesund zu sein. Erst in der Blütezeit macht sich die Krankheit bemerkbar: Wo normalerweise Mais- oder Hirsekörner wachsen, bilden sich nun große Mengen an Pilzsporen. "Brandpilze sind biotrophe Pilze, d. h. sie nutzen lebendige Pflanzen, um sich zu vermehren", erklärt Prof. Dr. Jan Schirawski. Er ist neuer Professor für Genetik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und hat sich auf das Erbgut der Brandpilze spezialisiert.
"Brandpilze zeichnen sich vor allem durch ein sehr enges Wirtsspektrum aus", erklärt Schirawski. "Zumeist befallen sie eine ganz bestimmte Pflanzenart, in seltenen Fällen zwei oder drei." Das gilt auch für den Mais-Kopfbrandpilz. Zwar kann er als Art sowohl Mais als auch Hirse infizieren, doch bisher ist kein einziger Stamm bekannt, der beides gleich gut beherrscht. Mit seiner Forschung will Schirawski herausfinden, warum die einzelnen, genetisch sehr ähnlichen Stämme bei der Wahl ihrer Wirtspflanze so wählerisch sind. "Wir konnten das Genom des Mais-Kopfbrandpilzes bereits vollständig entschlüsseln, haben aber die entscheidende Gensequenz noch nicht identifiziert", sagt der aus dem Rheinland stammende Genetik-Experte. Das liegt vor allem daran, dass schon ein winziger Unterschied - z. B. eine vertauschte Aminosäure - den Ausschlag dafür geben könnte, dass sich ein Pilz einen anderen Wirt sucht.
Befall einer Maispflanze im männlichen Blütenstand durch den Mais-Kopfbrandpilz. Der Name stammt von den dunkelbraunen Pilzsporen, die der Pflanze bei starkem Befall den Eindruck des Verbrannt-Seins verleihen. Foto: Jan Schirawski
Auf der Suche nach Antworten experimentiert Schirawski mit Hybriden. Er kreuzt Mais- und Hirse-befallende Pilzerreger miteinander und erzeugt so zahlreiche Nachkommen, von denen jeder neue Erreger einen anderen Teil des Genoms der Elterngeneration in sich trägt. Dann trennt er die infektiösen von den nicht-infektiösen Nachkommen und sucht innerhalb der jeweiligen Gruppe nach genetischen Gemeinsamkeiten. "Mit dieser Methode konnten wir eine vielversprechende Region von 50 Genen isolieren, aber das sind immer noch zu viele Kandidaten", so Schirawski. Um die Suche weiter einzugrenzen, will er im nächsten Schritt die isolierte Genregion des Hirse-infizierenden Pilzes mit dem entsprechenden Genomabschnitt des Mais-infizierenden Pilzes ersetzen - und dann die Ansteckungsfähigkeit erneut überprüfen.
Die Grundlagenforschung, die Prof. Schirawski leistet, kommt der Landwirtschaft zugute. Zwar ist der Mais-Kopfbrandpilz hierzulande nicht sehr weit verbreitet, weil größtenteils behandeltes Saatgut eingesetzt wird. In ärmeren und wärmeren Ländern, z. B. in Mexiko, breitet er sich hingegen immer weiter aus und sorgt für Ernteausfälle. Auch in der Biolandwirtschaft könnte der Parasit zum Problem werden. Eine mögliche Gefahr besteht darin, dass er mutiert und weitere Pflanzenarten befällt. Schirawski glaubt, dass dies in der Vergangenheit, vermutlich vor vielen Millionen Jahren, schon einmal passiert ist: "Wir nehmen an, dass der Mais-Kopfbrandpilz einmal ein reiner Krankheitserreger von Hirse gewesen ist, der im Laufe der Evolution auf den Mais übergesprungen ist."
Jan Schirawski studierte Chemie an der Universität Düsseldorf und promovierte anschließend an der Universität Mainz über die Regulation des Elektronentransportes einer bestimmten Bakteriengattung. Nach Auslandsaufenthalten in Frankreich und Irland forschte er ab 2001 am Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie in Marburg erstmals zu Pilz-Pflanzen-Interaktionen. Diese Forschungen führte er als Professor an der Uni Göttingen und der RWTH Aachen fort, bevor er nun an die Universität Jena wechselte. "Jena ist eine junge und lebendige Stadt, in der man sich schnell heimisch fühlen kann", findet der passionierte Ruderer, der sowohl im Universitätssportverein als auch im Jenaer Kanu- und Ruderverein aktiv ist.
TB
-
Giancarlo Soavi
Mehr erfahrenJProf. Giancarlo Soavi
Die Ausschreibung kam wie gerufen und sie passte perfekt: Als Giancarlo Soavi im vergangenen Jahr hörte, dass die Friedrich-Schiller-Universität Jena einen Juniorprofessor für Optik zweidimensionaler Festkörper sucht, entschied sich der Nachwuchsphysiker ohne Zögern, sich zu bewerben. Nicht nur, dass dieses Fachgebiet genau auf seine eigene Expertise zugeschnitten ist, auch der "exzellente Ruf, den die Universität Jena im Bereich Optik und Photonik hat", ermunterten ihn zu diesem Schritt. Und den hat er mit Erfolg absolviert. Inzwischen hat der 31-jährige Italiener seine Postdoc-Stelle an der renommierten University of Cambridge (UK) verlassen und die Ernennungsurkunde zum Juniorprofessor der Universität Jena in Empfang genommen.
Die Juniorprofessur ist im Institut für Festkörperphysik angesiedelt und gilt zunächst für vier Jahre. Nach erfolgreicher Evaluation wird sie in eine reguläre Professur überführt.
Soavis Forschungsschwerpunkt ist der Spektroskopie ultraschneller Phänomene gewidmet. "Wir nutzen ultrakurze, nur wenige Femtosekunden dauernde Lichtpulse, um ihre Wechselwirkung mit Nanomaterialen zu untersuchen", erläutert der Forscher. Während seiner Postdoc-Zeit in Cambridge hat sich Soavi dabei vor allem auf das Material Graphen fokussiert. "Dieses sehr dünne, nur aus einer Lage von Kohlenstoffatomen bestehende Material verfügt über eine Reihe ganz besonderer Eigenschaften", sagt Soavi. Seine zweidimensionale Struktur macht Graphen beispielsweise zu einem Supraleiter, in dem elektrischer Strom praktisch ohne Widerstand fließen kann.
"Auch für Licht ist Graphen ein besonderes Material, so dass es für verschiedene photonische Anwendungen besonders interessant ist", so Soavi. Graphen könne Licht absorbieren und in anderer Frequenz (Farbe) wieder abgeben. Das lasse sich beispielsweise zur Erzeugung von Laserstrahlung nutzen. In einer viel beachteten, kürzlich im Fachmagazin Nature Nanotechnology erschienenen Arbeit hat Soavi mit seinem Team aus Cambridge erstmals nachgewiesen, dass sich ein als "Third Harmonic Generation" (Frequenzverdreifachung) bezeichneter Effekt in Graphen durch ein von außen angelegtes elektrisches Feld verstärken und kontrollieren lässt. "Damit haben wir praktisch einen Schalter entwickelt, mit dem wir die Umwandlung von Licht in Strahlung anderer Frequenz gezielt steuern können", erläutert Soavi. Solche Graphen-basierten optischen Schalter könnten dazu beitragen, Bandbreite und Reichweite in der optischen Datenübertragung deutlich zu erhöhen.
Geboren und aufgewachsen ist Giancarlo Soavi in Mailand. Nach dem Besuch einer Militärakademie hat er an der Technischen Universität Mailand ("Politecnico") studiert und wurde 2015 mit seiner Arbeit "Ultrafast Photophysical Properties of Low-Dimensional Materials" dort auch promoviert. Während der Promotionszeit war er bereits das erste Mal für einige Monate in Deutschland – an der Uni Konstanz in der Gruppe des Experimentalphysikers Prof. Dr. Alfred Leitenstorfer.
Jena und seine Universität lernt der italienische Forscher, der sich in erster Linie als Europäer sieht, gerade erst kennen. "Die Stadt war mir als Wirkungsstätte von Carl Zeiß und gewissermaßen als Geburtsort der Mikroskopie natürlich ein Begriff", sagt er. Doch die vielfältigen Wissenschafts-, Kultur- und Sportangebote von Jena und seiner Universität sind für ihn eine "sehr positive Entdeckung", die er intensiv nutzen will. Seine Freizeit verbringt er vor allem sportlich und das sowohl als Einzelkämpfer mit Schwimmen oder Boxen als auch im Team mit Rudern und Beachvolleyball.
US
-
Cord Spreckelsen
Cord Spreckelsen
Foto: Heiko Hellmann/UKJLaborwerte, Vergütungssätze, Arzneimittelwechselwirkungen oder Klinikdienstpläne – Art und Umfang der Daten, die im Gesundheitswesen erfasst, verarbeitet und übermittelt werden, nehmen ständig zu. Dass diese Informationen in der richtigen Form, im richtigen Moment und an der richtigen Stelle verfügbar sind, ist Gegenstand der Medizininformatik. „Das Fach verbindet die wissenschaftlichen Methoden der Informatik mit den medizinischen Inhalten und IT-Anwendungen in der Gesundheitsversorgung“, so Prof. Dr. Cord Spreckelsen, seit Juli Professor für Medizininformatik am Universitätsklinikum Jena. Seine zukünftig vierköpfige Arbeitsgruppe ist am Institut für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften angesiedelt.
Einer der wichtigsten Partner des 54-jährigen Medizininformatikers wird das SMITH-Konsortium sein, ein vom Bundesforschungsministerium geförderter Verbund, an dem das Jenaer Uniklinikum und die Friedrich-Schiller-Universität beteiligt sind. Die Verbundpartner entwickeln Methoden und Infrastrukturen, um Routinedaten aus der Krankenversorgung für die patientenorientierte Forschung zu nutzen. Damit Daten aus verschiedenen Dokumentationssystemen verarbeitet und sinnvoll interpretiert werden können, müssen sie bestimmte Voraussetzungen an die Qualität der Informationen und deren semantische Interoperabilität erfüllen. Diese inhaltliche Integration von Daten ist ein wissenschaftlicher Schwerpunkt von Cord Spreckelsen: „Bei der automatisierten Zusammenführung klinischer Daten kommen angesichts der Komplexität der medizinischen Terminologie und sich mitunter ändernder Klassifikationsstandards auch Methoden der künstlichen Intelligenz einschließlich maschineller Lernverfahren zur Einsatz.“
Das gilt ebenso für die Umsetzung von medizinischem Wissen für eine digital assistierte Entscheidungsfindung. „Dabei nutzen wir nicht nur etablierte Methoden, sondern entwickeln die Methodik für medizininformatische Fragestellungen weiter“, betont Spreckelsen. Als einen weiteren Schwerpunkt nennt er die Analyse von Verbrauchsmengen, Materialströmen und Auslastungszahlen im Klinikbetrieb mit dem Ziel einer verbesserten Ressourcen- und Prozessplanung, zum Beispiel um weniger Material nach Ablauf des Verfallsdatums ungenutzt entsorgen zu müssen. Ein zentrales Thema sei natürlich auch der Datenschutz. „Wir verwenden und entwickeln Verfahren, um Daten für Forschungsfragestellung nutzen zu können, ohne dass dabei der Bezug zu einzelnen Personen hergestellt werden kann“, sagt Cord Spreckelsen, und erklärt gleich am Beispiel, wie kompliziert das ist: „Wenn die Daten nur genug genetischen Code enthalten, dann lassen sie sich gar nicht mehr anonymisieren.“
Cord Spreckelsen hat in Heidelberg Physik studiert und ist über einen Studentenjob zur Medizininformatik gekommen. Als Doktorand wechselte er dann an das Uniklinikum Aachen und wurde in der Informatik promoviert. Am Institut für Medizinische Informatik der RWTH Aachen leitete er die Abteilung „Wissensbasierte Systeme“ und beschäftigte sich in seiner Habilitation mit dem Wissensmanagement medizinischer Lehr- und Lernangebote. Zuletzt arbeitete er als stellvertretender Institutsdirektor und war auf Aachener Seite an den SMITH-Projekten beteiligt.
E-Learning und computerunterstützte Ausbildung sind aber nicht nur ein Forschungsschwerpunkt, das Lehren selbst liegt Professor Spreckelsen am Herzen. Deshalb absolvierte er ein zusätzliches Masterstudium in Medizindidaktik und engagiert sich für innovative Lehrformate - mit großem Erfolg, wie mehrere Lehrpreise belegen. „Das Medizinstudium muss die künftigen Ärzte und Ärztinnen auf den hohen Grad der Digitalisierung in Kliniken und Praxen vorbereiten“, ist er überzeugt, „die Studierenden fordern das auch ein.“ Geplant sind auch neue Module mit medizininformatischen Inhalten, um Studierende der Informatik stärker für das Fach zu interessieren.
(vdG)
-
Martin Walter
Mehr erfahrenExterner LinkMartin Walter
Foto: Michael Szábo/UKJKleine Universitätsstadt im Flusstal – Martin Walter ist das Ambiente vertraut. Der neue Professor für Psychiatrie kommt aus Tübingen nach Jena. Mit der Professur übernimmt er die Leitung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Philosophenweg. In Tübingen arbeitete Prof. Walter als leitender Oberarzt an der psychiatrischen Universitätsklinik und forschte als Professor für Biomedizinische Bildanalyse auch am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik.
Die Messung und Darstellung funktioneller Veränderungen im Gehirn bei neuropsychiatrischen Erkrankungen ist ein Forschungsschwerpunkt von Martin Walter. Dazu setzt er verschiedene Bildgebungsverfahren wie EEG und MRT ein. Über große Erfahrung verfügt er auch in der klinischen Forschung zur Pharmakotherapie, vor allem bei Depressionen, bei denen bewährte Medikamente nicht helfen. Er war zum Beispiel an den ersten Studien zum Einsatz von Ketamin bei therapieresistenten Depressionen beteiligt, welches inzwischen zunehmend Anwendung findet.
Martin Walter ist es wichtig, in der Behandlung psychisch Erkrankter alle seelischen, körperlichen und sozialen Aspekte des Patienten zu betrachten und dabei die verschiedenen Therapieformen so einzusetzen, dass sie sich nicht nur ergänzen, sondern gegenseitig verstärken können. Als einen solchen Ansatz beschreibt er die biologische Augmentation: „Durch elektrische oder Feedback-Stimulationsverfahren zusammen mit pharmakologischer Behandlung können wir die Lernfähigkeit des Gehirns verbessern. Auf diese Weise lässt sich die Wirkung psychotherapeutischer Behandlung erhöhen.“
Nach seinem Studium der Medizin und Philosophie an den Universitäten Magdeburg und Lyon absolvierte Martin Walter seine Facharztausbildung zum Psychiater und Psychotherapeuten ebenfalls in Magdeburg. Hier leitete er eine eigene Arbeitsgruppe in der Neuropsychiatrie am Leibniz-Institut für Neurobiologie und habilitierte sich mit der neurophysiologischen Untersuchung der gestörten Verarbeitung positiver Reize bei Depression. Auslandsaufenthalte in Stanford, Harvard und als Fellow der chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking förderten den Aufbau eines eigenen wissenschaftlichen Netzwerkes. Vor vier Jahren wechselte Walter nach Tübingen.
Prof. Walter betont den translationalen Ansatz seiner Forschung, die immer eine klinische Relevanz der wissenschaftlichen Fragestellungen voraussetzt. Diese Zugewandtheit zu den psychisch erkrankten Patienten zeigt sich auch an dem Ziel, dass er in der Lehre verfolgt. Er möchte den Studierenden ein Grundverständnis für die Psychiatrie vermitteln, damit sie später auch als Kardiologen, Unfallchirurgen oder Hausärzte entsprechend auf Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen eingehen können.
Mit seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten in der Bildgebung und der Behandlung neurodegenerativer und affektiver Erkrankungen passt Martin Walter sehr gut in das Forschungsprofil des Universitätsklinikums Jena. Es ist sein Ziel, die Sichtbarkeit der traditionsreichen Jenaer Klinik als Standort der psychiatrischen Wissenschaft auch überregional weiter auszubauen.
-
Oksana Yakimova
Mehr erfahrenExterner LinkDenomination: Algebraische Lie-Theorie
zuvor: Universität Köln
-
Julie Zedler
Julie Zedler
Foto: privat/ZedlerDer „rote Faden“ in Julie Zedlers wissenschaftlicher Arbeit ist — grün. Die Nachwuchsforscherin hat sich auf einzellige, photosynthetische Mikroorganismen spezialisiert. Als Biologin erforscht sie Cyanobakterien und ist vor wenigen Monaten an die Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen worden. Hier hat Julie Zedler nun die Juniorprofessur für Synthetische Biologie photosynthetischer Organismen inne.
Cyanobakterien kommen sowohl im Süß- als auch im Salzwasser vor. Es gibt mehrere Tausend Arten dieser Einzeller, die buchstäblich von Luft und Licht leben. „Diese Mikroorganismen betreiben Photosynthese, das heißt, sie fixieren Kohlendioxid (CO2) und produzieren daraus organisches Material“, erläutert Julie Zedler. Wichtiger Nebeneffekt: Bei der Photosynthese entsteht der für uns und andere Organismen lebensnotwendige Sauerstoff. „Für etwa die Hälfte der globalen Sauerstoffproduktion ist marines Plankton verantwortlich, einen großen Anteil daran haben Cyanobakterien“, unterstreicht Prof. Zedler die große Bedeutung dieser winzigen Organismen.
Die gebürtige Stuttgarterin befasst sich seit gut zweieinhalb Jahren mit Cyanobakterien, seit sie 2017 mit einem Marie Skłodowska-Curie Fellowship als Postdoc an die Universität Kopenhagen kam. Während ihres dortigen Forschungsaufenthaltes widmete sie sich vor allem der Molekularbiologie dieser Einzeller. „Bisher ist noch gar nicht im Detail verstanden, was Cyanobakterien eigentlich alles können“, sagt Zedler. „Klar ist jedoch, dass sie die Fixierung von CO2 deutlich effizienter betreiben als etwa grüne Pflanzen.“
Die Wissenschaftlerin und ihr Team wollen deshalb herausfinden, wie das den Cyanobakterien gelingt und wie sich diese Prozesse nutzen lassen. „Unsere Idee ist es, Cyanobakterien als ,Zellfabriken’ zu verwenden und sie beispielsweise dazu zu bringen, das fixierte CO2 in etwas umzusetzen, das für uns Menschen von Nutzen ist.“ Statt einfach Biomasse zu produzieren, könnten die Mikroben also zum Beispiel bestimmte Enzyme oder Naturstoffe herstellen. In ihrem Forschungslabor untersucht Julie Zedler dafür natürliche und gentechnisch modifizierte Bakterienkulturen. „Erst einmal ist das Grundlagenforschung“, erläutert sie. Ein grundlegendes Verständnis der Stoffwechselprozesse sei jedoch die Voraussetzung für die systematische und gezielte Entwicklung der kleinen „Zellfabriken“.
Angefangen hat Julie Zedler ihre Karriere mit einem Biologie-Studium an der Universität Konstanz. In dieser Zeit schon wurde ihr Interesse an kleinen grünen Organismen geweckt: Bereits in ihrer Bachelorarbeit befasste sie sich mit Grünalgen. Ein Erasmus-Stipendium ermöglichte ihr später einen Auslandsaufenthalt in Schottland, wo sie beschloss, wie in Großbritannien nicht unüblich, direkt an den Bachelor eine Promotion anzuschließen. Ihre Doktorarbeit hat sie an der University of Kent in England angefertigt — ebenfalls zu Grünalgen.
Angekommen in Jena plant Julie Zedler nun, ihren Blick auf die Cyanobakterien zu erweitern und die Mikroorganismen nicht mehr nur als Einzelkultur, sondern in Organismenverbänden zu betrachten. „Hier am Forschungsstandort Jena gibt es zahlreiche, herausragende Expertise für mikrobielle Ökosysteme und Konsortien von Organismen“, sagt Zedler. Das biete interessante Anknüpfungspunkte für sie und die Arbeit ihres kleinen Teams. Im Moment ist sie erst einmal froh, nach der Corona-Pause erste Experimente in ihrem neuen Labor machen zu können. Gerade ist eine neue Kultivierungsanlage für Cyanobakterien in Betrieb gegangen — die Photosynthese läuft also schon mal.
(U. Schönfelder)