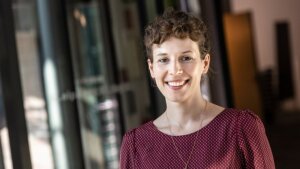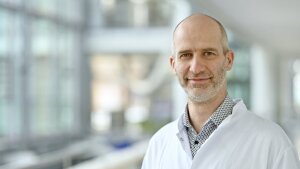Neuberufene 2021
-
Rosalind Allen
Prof. Allen
Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Ein tiefgreifendes Verständnis darüber, wie Bakterien in verschiedenen Umgebungen wachsen, überleben oder sterben, kann die Behandlung von bakteriellen Infektionen grundlegend verändern. „Es ist wichtig, Antibiotika zielgerichtet einzusetzen, denn zu viele Fehlbehandlungen können zu Resistenzen führen", erklärt Prof. Dr. Rosalind Allen. Sie ist seit kurzem Professorin für Theoretische Mikrobielle Ökologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und mit ihrem Team im Exzellenzcluster „Balance of the Microverse“ angesiedelt.
Prof. Allen wechselte von der University of Edinburgh an die Universität Jena. Ihren Einstieg in die Wissenschaft bildete ihr Chemie-Studium an der Universität Cambridge, anschließend wechselte sie das Fach und wurde Physikerin. In ihrer Forschung kombiniert sie ihre Fachgebiete: Prof. Allen nutzt Methoden aus der Physik, um aktuelle Erkenntnisse aus mikrobiologischen Experimenten zu erklären. Genauer gesagt, beschreibt sie mit Gleichungen, wie Bakterien in verschiedenen Umgebungen wachsen und welchen Einfluss dies auf die Wirkung von Antibiotika hat.
„Die einfache Vorstellung, wonach Antibiotika Bakterien abtöten, ist in Wirklichkeit viel komplexer", sagt Prof. Allen. Bakterien wachsen in ganz unterschiedlichen Umgebungen, wie zum Beispiel im menschlichen Darm oder im Boden, aber auch in medizinischen Implantaten oder Kathetern. Je nach Umgebung wachsen Bakterien aber unterschiedlich schnell. Gleichzeitig beeinflusst die Wachstumsgeschwindigkeit der Bakterien die Wirkung von Antibiotika. Was also in der einen Umgebung zur Abtötung von Bakterien führt, kann in einer anderen völlig unwirksam sein. Prof. Allen versucht mit ihrer Forschung, die Gründe hierfür herauszufinden. Indem sie die bakteriellen Wachstumsprozesse in mathematische Gleichungen umwandelt, lassen sich Erkenntnisse gewinnen, die aus rein biologischer Sicht vielleicht nicht möglich gewesen wären.
Ein weiterer Vorteil davon, Biologie und Physik zu kombinieren, ist, dass sich komplexe Prozesse so visualisieren und damit vergleichen lassen. Die Formel für die Wechselwirkung von Bakterien mit Antibiotika könnte beispielsweise einer Formel ähneln, die den Angriff auf eine Bakterienpopulation durch einen Feind beschreibt und wäre aus rein biologischer Sicht möglicherweise nicht erkannt worden. „Wir wollen systemübergreifende Konzepte finden, die sonst möglicherweise übersehen werden“, fasst Prof. Allen zusammen. Das Konzept, zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Prozesse miteinander zu vergleichen, passt sehr gut in den Microverse-Cluster, der verschiedene Forschungsbereiche miteinander verbindet.
„Eines meiner Ziele ist es, einen geschickten Weg zu finden, um bakterielle Infektionen gezielt mit Antibiotika zu behandeln. Zurzeit gibt es klinische Richtlinien, die beschreiben, welches Antibiotikum bei welcher Infektion eingesetzt werden sollte. Doch diese basieren nicht immer auf einem detaillierten Verständnis darüber, wie die Bakterien auf das Antibiotikum reagieren“, erklärt Prof. Allen. Die Wissenschaftlerin freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen des Universitätsklinikums, die ebenfalls zum Microverse-Cluster gehören. Im Rahmen dieser fachübergreifenden Zusammenarbeit soll das Thema von einem praktischen Standpunkt aus beleuchtet werden.
Prof. Allen interessiert sich ebenfalls dafür, wie verschiedene Arten von Mikroben im Boden, im Meer, auf Pflanzen oder im Menschen zusammenwirken. „Jena ist eine Hochburg des Fachwissens für mikrobielle Interaktionen, und ich möchte mit Hilfe mathematischer Modelle vorhersagen, wie sich diese Interaktionen auf die Stabilität der natürlichen Umwelt und auf die Gesundheit von Menschen und Pflanzen auswirken“, sagt sie. Jemanden wie Prof. Rosalind Allen im Microverse-Cluster zu haben, bietet die Möglichkeit, Forschende fachübergreifend zu verbinden und neue Gemeinsamkeiten zwischen Wissensgebieten zu entdecken.
Darüber hinaus wird sich Prof. Allen in der Lehre im Masterstudiengang „Mikrobiologie“ engagieren und Studierenden die Modellierung in der Mikrobiologie nahebringen.
Seit ihrem Umzug nach Jena hatten Prof. Allen und ihre Familie bereits etwas Zeit, um die Stadt zu erkunden. Mit zwei Töchtern erfreut sich die Familie besonders am Galaxsea-Schwimmbad sowie der schönen Natur rund um Jena.
Nora Brakhage
-
Bas Dutilh
Denomination: Viral Ecology
zuvor: Utrecht University
-
Tanja Groten
Tanja Groten
Foto: Ann Schroll/UKJEs ist die Vielseitigkeit, die Tanja Groten an der Frauenheilkunde und besonders der Geburtsmedizin schätzt: „Da ist alles drin, wir kümmern uns um gesunde Frauen, um Schwangere mit chronischen Erkrankungen und um Patientinnen, die in der Schwangerschaft erkranken. Dabei nutzen wir viele medizinische Teilgebiete, wie zum Beispiel Endokrinologie und Kardiologie oder die Gefäßambulanz“, so die neu ernannte Professorin für Geburtsmedizin und maternale Gesundheit am Universitätsklinikum Jena (UKJ). Die an der Klinik für Geburtsmedizin neu eingerichtete Professur widmet sich neben der allgemeinen Geburtshilfe vor allem den Patientinnen unter den Schwangeren.
Die Oberärztin und stellvertretende Klinikdirektorin ist nicht nur Gynäkologin, sondern auch Diabetologin und leitet das Kompetenzzentrum Diabetes und Schwangerschaft am UKJ. In ihm kümmert sich ein interdisziplinäres Team um schwangere Diabetikerinnen und um Frauen, deren Zuckerstoffwechsel in der Schwangerschaft aus den Fugen gerät. Ein solcher Gestationsdiabetes tritt in fast jeder zehnten Schwangerschaft auf; die Hälfte der Schwangeren mit Zuckerstoffwechselstörung entwickelt später auch einen Typ-2-Diabetes. „Dieses Risiko kann durch eine gute Behandlung und Beratung in der Schwangerschaft und in den Jahren danach gesenkt werden. Deshalb geht es uns nicht nur um die Behandlung des Gestationsdiabetes mit dem Ziel, die Kinder vor den Folgen des „zu viel“ an Zucker im Mutterleib zu schützen, sondern auch um die langfristige Nachsorge für die Mütter, die wir mit den Hausärzten gemeinsam etablieren wollen“, betont Tanja Groten.
Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf der Erforschung und besseren Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen, die mit einer gestörten Funktion der Plazenta in Zusammenhang stehen. Eine Unterfunktion der Plazenta kann zu einer Mangelversorgung und verlangsamten Entwicklung des Kindes führen. Manchmal ist eine solche Minderdurchblutung der Plazenta von erhöhtem Blutdruck und Gefäßproblemen bei der Mutter begleitet, was in die Schwangerschaftserkrankung Präeklampsie münden kann. „Wir vermuten, dass die Kommunikation zwischen der Plazenta und dem Endothel der Mutter auf molekularer Ebene gestört ist“, so Tanja Groten. Mit ihrer Arbeitsgruppe im Plazentalabor untersucht sie die Funktion des Gewebes in den mütterlichen Gefäßen. Neue Forschungsprojekte zur Analyse von Altersmakern in der Plazenta oder den Alternsprozessen des Endothels stehen in den Startlöchern.
Kürzlich konnte sie eine große, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte klinische Studie zur vorbeugenden medikamentösen Behandlung von Risikoschwangeren mit einer Unterfunktion der Plazenta abschließen. Noch vor der Veröffentlichung der Ergebnisse plant Prof. Groten die Folgeuntersuchung in ihrer Studiensprechstunde: „Wir wissen, dass das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen nach einer Präeklampsie erhöht ist. Deshalb wollen wir die Gefäßfunktion dieser Patientinnen langfristig nachuntersuchen, um den Einfluss der Schwangerschaft auf die Gefäßalterung besser zu verstehen.“
Neben der Erforschung der Krankheitsmechanismen möchte Tanja Groten auch die langfristige Betreuung und Nachsorge von Müttern mit Präeklampsie und verzögertem Wachstum des Babys verbessern. Diese Frauen erkranken überdurchschnittlich oft an Herzinfarkt oder Schlaganfall - und das bereits in den ersten 20 Jahren nach der Schwangerschaft. Für sie gibt es bisher keine etablierten Nachsorgeprogramme, obwohl sie seit längerem als Risikokollektiv erkannt sind. „Hier liegt mir der Aufbau einer Struktur für die individualisierte Nachsorge in Zusammenarbeit mit unseren Kardiologen sehr am Herzen!“, so Prof. Groten.
Die Medizinerin wechselte nach dem Studium und der Promotion in ihrer Geburtsstadt Aachen an die Universitätsfrauenklinik Ulm und absolvierte dort die Weiterbildung zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie forschte mit einem DFG-Stipendium zwei Jahre an der Northwestern University Chicago und als Gastwissenschaftlerin an der Medizinischen Universität Graz. Seit 2008 arbeitet Tanja Groten am UKJ und habilitierte sich hier mit ihren grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten zu den plazentaren Ursachen von Schwangerschaftskomplikationen. Sie arbeitet in den Gleichstellungsgremien von Fakultät und Klinikum mit und engagiert sich in wissenschaftlichen und berufspolitischen Einrichtungen der medizinischen Fachgesellschaften. Wegen des attraktiven Forschungsumfelds an der Jenaer Unigeburtsmedizin lehnte sie für die Professur den Ruf auf einen Lehrstuhl an der Uni Bonn ab.
Dass die Frauenheilkunde und Geburtsmedizin mit Vorlesung, Hands-on-Kursen und Praktika erst im neunten Semester des Medizinstudiums verankert ist, bedauert Tanja Groten. „Oft haben sich die Studierenden dann schon für ein Wahlfach entschieden.“ Sie möchte die Vielseitigkeit ihres Faches nutzen, um z. B. in themenübergreifenden Lehrangeboten schon früherer Semester dafür zu werben. Dabei ist ihr wichtig, dass es als Perinatalmedizin, also Geburtsmedizin, zusammen mit der Neonatalogie als gemeinsames Fach verstanden wird. Prof. Groten ist sich sicher, Studierende von der Attraktivität ihres Fachgebiets überzeugen zu können: „Für uns stehen die werdende Mutter und ihr Kind im Mittelpunkt. Wir wollen Risiken abmildern, die aus bestehenden oder durch die Schwangerschaft auftretenden gesundheitlichen Probleme resultieren, und den Verlauf positiv beeinflussen – um für Mutter und Kind besten Start ins gemeinsame Leben ermöglichen.“
(UKJ/Uta von der Gönna )
-
Johannes Hackl
Johannes Hackl
Foto: Jürgen Scheere (Universität Jena)Es habe einen ganz besonderen Reiz, mit Texten zu arbeiten, die seit tausenden Jahren nicht mehr gelesen wurden, sagt Prof. Dr. Johannes Hackl. Der Österreicher ist neuer Inhaber des Lehrstuhls für Altorientalistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Leidenschaft sind Keilschrifttafeln aus Babylonien, tönerne Zeugnisse aus der Frühzeit der menschlichen Zivilisation. „Mein Interesse gilt insbesondere der Zeit um das 6. Jahrhundert vor Christus“, sagt Johannes Hackl. Heißt, er liest Keilschrifttexte, die in Sumerisch oder Babylonisch-Assyrisch (Akkadisch) verfasst wurden, den wichtigsten altorientalischen Sprachen. Ein spezielles Interesse Hackls gilt den jüngeren babylonischen Dialekten des Akkadischen. Mit dem Erschließen der Texte lassen sich Geschehnisse jener längst vergangenen Zeiten rekonstruieren. Dennoch bleibt es ein dynamisches Forschungsgebiet: „Noch heute werden bei Ausgrabungen spannende Funde gemacht“, sagt Johannes Hackl. Weitere Entdeckungen seien in Museen möglich, denn längst nicht jeder Text wurde bereits übersetzt.
Das Lesen und Übersetzen der Keilschrifttexte ist natürlich kein Selbstzweck. Die Texte in Form von Urkunden, Briefen und Listen geben detaillierte Einblicke in den Alltag vor 2.500 bis 3.000 Jahren, sie legen Wirtschaftsbeziehungen ebenso offen wie soziale Strukturen. Einer breiteren Öffentlichkeit seien freilich vor allem literarische Texte bekannt, konstatiert Johannes Hackl. Eine Sternstunde seines Faches feierte der britische Assyrologe George Smith, dem es 1872 gelang, die Sintfluterzählung des Gilgamesch-Epos zu übersetzen. Dadurch entdeckte Smith die Parallelen zu den bekannten Passagen in der hebräischen Bibel. Solche spektakulären Funde bleiben sicherlich die Ausnahme, ausgeschlossen sind sie jedoch nicht.
Gegenwärtig arbeitet Prof. Hackl an einem Privatarchiv, das im Irak geborgen wurde. Geführt über mehrere Generationen, dokumentiert es das Alltagsleben einer Familie, die in der Landwirtschaft unternehmerisch tätig war. „Manche der Texte gehören archivalisch zu Texten, die im Vorderasiatischen Museum in Berlin und im Louvre in Paris aufbewahrt werden“, sagt Johannes Hackl. Damit werfen die Keilschrifttafeln zugleich ein Schlaglicht auf die Sammlungsgeschichte: Westliche Forscher und Sammler kauften im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wahllos an, was ihnen gefiel. Lokale Händler und Raubgräber profitierten ebenfalls vom Interesse der Europäer und Amerikaner. Das stellt Forscherinnen und Forschern die Aufgabe, mühsam Zusammenhänge zwischen einzelnen Textfunden herzustellen. Der illegale Antikenhandel mit archäologischen Funden bleibt bis heute ein lukratives Geschäft. Das Archiv, das Johannes Hackl zusammen mit einer irakischen Kollegin bearbeitet, wurde von der irakischen Antikenbehörde konfisziert und dem Irakischen Nationalmuseum in Bagdad übergeben.
Johannes Hackl ging in Freistadt (Oberösterreich) zur Schule und studierte in Wien Altorientalische Philologie und Orientalische Archäologie. Das Interesse für Geschichte war schon in der Schule ausgeprägt und wurde durch einen charismatischen Geschichtslehrer weiter befeuert. Einen ganz besonderen Reiz hatten die Sprachen für ihn, sagt Prof. Hackl, deshalb der Schwerpunkt Philologie. Seine Promotion mit dem Titel „Materialien zu Recht, Wirtschaft und Gesellschaft im Nordbabylonien der spätachämenidischen und hellenistischen Zeit – Urkundenlehre, Archivkunde, Texte“ verfasste er in Wien. Danach ging Hackl als Humboldt-Stipendiat nach Leipzig. Dort entstand seine Habilitation mit dem Titel „Untersuchungen zur Periodisierung des Neubabylonischen“.
Seine neue Wirkungsstätte Jena sei für ihn etwas Besonderes, sagt Johannes Hackl: „Jena war ja mit Friedrich Delitzsch faktisch der Geburtsort der deutschen Altorientalistik.“ Sei es doch maßgeblich die Begegnung mit dem Alttestamentler Schrader im Gasthof Zur Sonne gewesen, die Delitzsch bewog, seine Sanskritstudien aufzugeben und sich ganz den Keilschrifttafeln und dem Babylonisch-Assyrischen zuzuwenden. Jenseits dieser historischen Finesse glänze Jena besonders durch die Hilprecht-Sammlung altorientalischer Altertümer, so der 40-Jährige. Prof. Hackl betreut die zweitgrößte Sammlung ihrer Art in Deutschland, ist mit der wissenschaftlichen Bearbeitung und Digitalisierung betraut. Zudem sei es gerade in der Lehre ein unschätzbarer Vorteil, wenn die Studierenden die originalen Keilschrifttafeln selbst in die Hand nehmen können.
Johannes Hackl ist verheiratet und lebt mit seiner Frau in Leipzig. In seiner Freizeit fährt er gern Rennrad, er liebt das Bergwandern und beschäftigt sich auch privat mit Sprachen.
Stephan Laudien
-
Andreas Hejnol
Prof. Hejnol
Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Moostierchen, Priapswürmer, Saitenwürmer und Armfüßer: Es sind teils bizarre Kreaturen, die Prof. Dr. Andreas Hejnol von der Friedrich-Schiller-Universität Jena erforscht. Der Evolutionsbiologe möchte etwa ergründen, welche ursprüngliche Funktion die Gene für Flügel und Beine bei einem bein- und flügellosen Meeres-Wurm haben. Oder zu welchem Zeitpunkt der Evolution diese Gene erstmals für die Ausbildung von Gliedmaßen sorgten. „Wir wissen, dass Beine evolutionär mehrfach entstanden sind“, sagt Andreas Hejnol. Das werfe die Frage nach dem dahinterliegenden Muster auf.
Aktuell erforscht der Professor für Zoologe, wie das Blut entstanden ist. Oder andersherum: Wie lösen Lebewesen ohne Blut den Sauerstofftransport und die Immunabwehr? Als Forschungsobjekte wählt Hejnol bevorzugt Tiere aus, die sonst kaum im Fokus der Forschung stehen, aber wichtig für das Verständnis der Evolution des Lebens sind. „Die meisten Studien konzentrieren sich auf Fadenwürmer, Insekten und Wirbeltiere und damit auf drei von 30 Großgruppen im Tierreich“, sagt Andreas Hejnol. Um evolutionäre Entwicklungen besser zu verstehen, sei es notwendig, den Blick zu weiten.
An der Universität Bergen in Norwegen konnten Andreas Hejnol und sein Team nachweisen, dass die Nieren ursprünglich aus gerade mal drei Zellen bestanden. Erstmals aufgetreten sind diese Vorläufer der heutigen Organe vor etwa 600 Millionen Jahren. Das zeigt die Stammbaumdatierung mit Hilfe sogenannter molekularer Uhren. Die Ergebnisse dieser Grundlagenforschung sind beispielsweise für die Medizin von großem Interesse. So könne beispielsweise die Veränderung eines alten Gens manchmal größere Wirkungen zeigen wenn es gilt, einen Gendefekt zu beheben. „Genkataloge sind ein sehr nützliches Hilfsmittel, um neue Therapien zu erforschen“, sagt Andreas Hejnol. Je breiter der Blick der Forscher, desto besser. Sei doch kaum vorhersehbar, was es angesichts von etwa zehn Millionen Tierarten noch alles zu entdecken gibt.
Die Mehrzahl von Hejnols Untersuchungsobjekten sind aquatische Lebewesen. Manche von ihnen lassen sich in Aquarien halten, andere werden auf eigenen Exkursionen gesammelt. Praktischerweise gibt es zudem in jedem Jahr ein meeresbiologisches Praktikum.
Andreas Hejnol ging in Bremen zur Schule und studierte an der FU Berlin Biologie. Sein Interesse am Fach wurde bereits in der frühen Kindheit geweckt, wie er sagt. „Tierbücher waren meine Lieblingsbücher und ich habe immer Tiere mit nach Hause gebracht.“ Promoviert wurde Andreas Hejnol mit einer Arbeit über die Beinentwicklung von Krebsen, danach ging er als Postdoc nach Braunschweig. Dort lernte er die Zeitraffer-Mikroskopie kennen, hatte zudem die Möglichkeit, die Embryogenese von Tieren zu beobachten, von der Eizelle bis zum fertigen Organismus. Die nächste Station war ein Institut auf Hawaii, wo er mit den Grundlagen molekularer Untersuchungsmethoden vertraut gemacht wurde. So ausgerüstet, nahm Andreas Hejnol eine Stelle im norwegischen Bergen an. Zunächst zehn Jahre lang als Leiter einer Arbeitsgruppe, weitere zwei Jahre als Professor. Seit Anfang Oktober lehrt und forscht er nun in Jena als Nachfolger von Prof. Dr. Dr. h. c. Martin S. Fischer, der in den Ruhestand ging, der Universität aber als Seniorprofessor erhalten bleibt.
Stichwort wissenschaftlicher Nachwuchs: Prof. Hejnol sagt, in guter Lehre gehe es weniger darum, Wissen zu vermitteln als vielmehr darum, die Studierenden zu kritischem Denken zu befähigen. Einer der neuen Postdocs wird aus Japan nach Jena kommen. Der junge Forscher möchte sich mit der Evolution der Häutung befassen. Erkenntnisse dazu könnten vielleicht einmal im Kampf gegen die Malaria von Nutzen sein.
Noch ist Andreas Hejnol dabei, sich in Jena einzuleben. „Die Stadt gefällt mir sehr gut, vor allem ihre Internationalität“, sagt der 52-Jährige. Bei seinen ersten Gängen durch die Stadt habe er erstaunlich viele verschiedene Sprachen gehört. Internationalität sei in der Wissenschaft selbstverständlich, so Hejnol. Er selbst habe eine Arbeitsgruppe geleitet, in der zeitgleich Vertreter von zwölf Nationen geforscht haben. Einen ersten Beitrag zu einem weltoffenen Jena möchte Andreas Hejnol als neuer Leiter des Phyletischen Museums leisten: „Die Texte im Museum sollten mindestens bilingual sein!“
In seiner Freizeit kocht Prof. Hejnol gern, er liest, vorzugsweise Bücher über Geschichte und Politik, und er ist sportlich aktiv: beim Wandern, Radfahren, Laufen und Schwimmen. Ein weiteres Hobby ist die Fotografie: „Beim Fotografieren kann man das Sehen lernen.“
Stephan Laudien
-
Ute Hellmich
Ute Hellmich
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Damit Infektionskrankheiten effektiv bekämpft werden können, müssen sie möglichst genau verstanden werden – und zwar bis auf die molekulare Ebene. „Wir wollen wissen, wie im Kontext von Infektionen bestimmte Proteine mit anderen Molekülen wechselwirken. Und wir möchten lernen, wie solche Proteine auf atomarer Ebene aussehen und wie sie sich bewegen, also wie ihre Dynamik beschaffen ist“, sagt Ute Hellmich, neue Professorin für Biostrukturelle Interaktionen an der Universität Jena, die innerhalb des Jenaer Exzellenzclusters „Balance of the Microverse“Externer Link angesiedelt ist.
Dass sich beim Erforschen der Wechselwirkungen von Biomolekülen Überraschendes herausfinden lässt, erklärt sie am Beispiel der sogenannten Trypanosomen: „Das sind einzellige Parasiten, die Tropenkrankheiten verursachen können, wie etwa die afrikanische Schlafkrankheit. Um zu überleben, brauchen diese Parasiten ein bestimmtes Enzym. Es gibt aber Moleküle, die dieses Enzym hemmen, also als Inhibitoren wirken. Wir wollten für einen dieser Inhibitoren herausfinden, wie das genau funktioniert.“ Als sie und ihr Team den chemischen Komplex untersuchten, den der Inhibitor mit dem Enzym bildet, stießen sie auf unerwartete Messsignale. „Zuerst dachten wir, dass wir Artefakte beobachteten“, erinnert sich die Biochemikerin. „Uns wurde aber bald klar, dass der Enzym-Inhibitor-Komplex sich mit einem weiteren identischen Komplex aus der Umgebung verbindet – er dimerisiert. Das Inhibitor-Molekül funktioniert dabei wie ein Kleber“, erklärt Hellmich. So entdeckte ihre Forschungsgruppe eines der kleinsten bekannten Moleküle, die dieses Verhalten zeigen. „Diese sogenannten Dimerizer sind von großer pharmazeutischer Bedeutung. Mit ihnen können zum Beispiel Signalwege in der Zelle kontrolliert werden“, ordnet Hellmich diese unerwartete Entdeckung ein.
Ein wichtiges Verfahren, mit dem sie die Interaktionen von Enzymen und anderen Biomolekülen untersucht, ist die Kernspinresonanz-Spektroskopie. „Mit dieser Methode lassen sich atomare Details komplexer biologischer Bausteine hervorragend untersuchen. Zusätzlich können wir auch die Dynamik unserer Proben studieren und damit ihre Funktion beschreiben“, erklärt die Wissenschaftlerin. „Wir wollen uns jedoch nicht zwanghaft auf eine einzelne Methode festlegen, sondern nutzen alle Möglichkeiten, um unsere jeweilige Fragestellung zu beantworten.“
Dazu braucht es viel Zusammenarbeit zwischen Fachleuten verschiedener Disziplinen. „Natürlich stammen die Proteine aus der Biochemie. In der Synthesechemie werden aber die Inhibitor-Moleküle hergestellt und verändert. Die Biophysikalische Chemie stellt die Untersuchungsmethoden bereit. Und die Theoretische Chemie hilft uns, aus den gewonnenen Informationen neue und verbesserte Strukturvorschläge abzuleiten“, fasst Hellmich zusammen.
Interdisziplinarität endet für Ute Hellmich aber nicht bei den Naturwissenschaften. „Eines unserer zentralen Forschungsthemen sind die sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten. Dabei spielen auch gesellschaftspolitische Faktoren eine entscheidende Rolle, wie Fragen der Nutztierhaltung, der Besiedelung, des Klimawandels, aber auch der Geschichte, zum Beispiel wenn es darum geht, zu verstehen, ob und wie Medikamente oder Impfstoffe entwickelt werden und für wen sie eigentlich verfügbar sind. Die Auswirkungen solcher Ungleichheiten sehen wir auch heute, etwa in der weltweiten Verteilung der Covid-Impfstoffe.“
Den Grenzweg zwischen Biochemie und Geisteswissenschaften beschreitet seit kurzem ein Doktorand in ihrer Gruppe. „Dieser Weg ist sehr ungewöhnlich für einen Naturwissenschaftler und ich bin gespannt, was aus dieser Arbeit, die auch für uns eine Premiere ist, herauskommt. Wir haben als Forschende die Verantwortung, rechts und links des Wegesrands zu schauen und unsere Themen auch über unseren Tellerrand hinaus zu betrachten.“
Nach ihrer Promotion an der Goethe-Universität Frankfurt/M. im Jahr 2010 forschte die Biochemikerin für einige Jahre an der Universität Harvard in Cambridge, Massachusetts (USA). Von 2015 bis 2020 war sie Juniorprofessorin für Membranbiochemie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, wo sie 2020 erfolgreich ihr Tenure-Track-Verfahren absolvierte. Seit diesem Jahr ist Ute Hellmich mit ihrer GruppeExterner Link nun in Jena.
Für die Biochemikerin ist das Umfeld an der Friedrich-Schiller-Universität dafür ideal. „Es ist ein Luxus, an einer so breit aufgestellten Universität zu arbeiten. Ich hoffe, dass sich hier viele neue Begegnungen ergeben.“ Dass diese bereits stattfinden, zeigt sich dadurch, dass, während sie ihr Labor in Jena noch aufbaut, bereits eine Bachelor-Studentin, eine Master-Studentin und eine Doktorandin aus Jena bei Ute Hellmich an ihren Abschlussarbeiten forschen.
(Körner)
-
Peter Huppke
Peter Huppke
Foto: Foto UKJ"Bei vielen Kindern und Jugendlichen sind neurologische Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Fieberkrämpfe und Auffälligkeiten in der körperlichen und geistigen Entwicklung der Grund für den Besuch in der Kinderarztpraxis. Meistens können die Kinderärzte die Eltern beruhigen und, wenn nötig, eine Behandlung einleiten. Wenn aber das heranreifende Nervensystem von einer akuten oder chronischen Erkrankung betroffen ist und dadurch die Entwicklung von Gehirn, Rückenmark, Nerven oder Muskeln gestört wird, sind die Spezialisten der Kinderneurologie, die auch als Neuropädiatrie bezeichnet wird, Ansprechpartner für die Familien.
Professor Peter Huppke kennt die Probleme der Eltern neurologisch kranker Kinder: „Meist ist es schon eine riesige Hilfe, wenn eine Diagnose gestellt wird. Damit endet für die Familien eine mitunter lange Suche, die oft auch von Selbstvorwürfen begleitet ist, sich in der Schwangerschaft oder frühen Elternschaft falsch verhalten zu haben.“ Der 53-jährige Kinderneurologe hat die Professur für Neuropädiatrie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena angenommen und leitet seit April die Klinik für Neuropädiatrie am Jenaer Universitätsklinikum. Das interdisziplinäre Team ist hochspezialisiert und nutzt für die Diagnosestellung neben der sorgfältigen Anamnese und körperlichen Untersuchung verschiedenste Laboruntersuchungen, neurophysiologische Funktionsmessungen, Bildgebung und kognitive Tests. Eine immer wichtigere Rolle spielen dabei genetische Untersuchungen. „Durch die Exomsequenzierung, also die Analyse aller Gene, die Informationen für die Proteinproduktion enthalten, lassen sich ursächliche genetische Veränderungen bei der Mehrzahl der Kinder finden“, so Peter Huppke.
Bei vielen Patienten führt eine multidisziplinäre Therapie durch ein Spezialistenteam aus den Bereichen Krankengymnastik, Psychologie, Logopädie, Ergotherapie und Neuropädiatrie zu einer Besserung der Beschwerden. Aber auch die medikamentöse Therapie macht in der Neuropädiatrie große Fortschritte. So können Patienten mit kindlicher Multipler Sklerose, einem Spezialgebiet von Prof. Huppke, die noch vor 15 Jahren von früher Behinderung bedroht waren, heute ein normales Leben führen. Mit Genersatztherapien wird es zunehmend möglich, auch seltene genetische Erkrankungen zu heilen. „Dazu müssen wir aber den Krankheitsmechanismus genau kennen“, betont Prof. Huppke. Die Beschreibung neuer Erkrankungen, die Untersuchung der zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen und die Entwicklung von Therapien sollen im Zentrum seiner Forschung in Jena stehen.
Nach seinem Medizinstudium in Göttingen absolvierte Prof. Huppke in der Universitätsmedizin Göttingen die Facharztausbildung für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und die Weiterbildung für den Schwerpunkt Neuropädiatrie. Er arbeitete als Oberarzt im Zentrum Kinderheilkunde und Jugendmedizin Göttingen, das auf dem Gebiet der Kinderneurologie besonders ausgewiesen ist. In der Forschung stand lange das Rett-Syndrom, eine schwere neurologischen Entwicklungsstörung, die nur bei Mädchen vorkommt, im Mittelpunkt. Die Arbeiten zu dem klinischen Verlauf, der Krankheitsursachen und der Therapie waren die Grundlage für seine Habilitation. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die seltenen neurologischen Erkrankungen und die entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems.
Als eigenständiges medizinisches Fach, das Kinderheilkunde und Neurowissenschaften verbindet, hatte sich die Neuropädiatrie erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet. Sie stellt besonders komplexe Versorgungsanforderungen, weil medizinische, psychologische und soziale Aspekte von Erkrankungen und eventuellen Behinderungen berücksichtigt werden müssen. Früherkennung und Vorsorge spielen eine zentrale Rolle. „Unser Team aus Ärzten, Psychologen und therapeutischen Fachkräften koordiniert im Sozialpädiatrischen Zentrum die ambulante, stationäre und rehabilitative Behandlung. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Lebensqualität unserer Patienten und ihrer Familien“, so Professor Huppke."(vdG)
-
Sarah Jäger
Mehr erfahrenSarah Jäger
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Was macht ein gutes, ein gelingendes Leben aus? Wie beantworten wir die großen Fragen, die zwischen Geburt und Tod kreisen? Welche Antworten bietet der Glaube, welche kann die Kirche geben? Um solche, im Kern existenzielle Fragen, kreist das Denken von Prof. Dr. Sarah Jäger. Die 35-jährige gebürtige Frankfurterin lehrt Systematische Theologie und Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Ethik, sagt die Juniorprofessorin (mit Tenure Track). „Allgemeingültige Antworten finden wir nicht, weil sich die Kristallisationspunkte unseres Denkens stetig verändern. Es gilt immer neu, biblische und theologische Überlieferungen mit Fragen unserer Zeit ins Gespräch zu bringen“, sagt Jäger. Als Beispiel führt sie den Umgang mit Menschen mit Behinderung an. So habe der Wandel von einer Anstaltsdiakonie hin zu angestrebten Formen eines weitgehend selbstbestimmten Lebens viele neue Fragen aufgeworfen. Fragen zudem, die sich durch das neue Bundesteilhabegesetz stellen, das im Frühjahr 2020 in Kraft trat.
Aktuell wird das Denken Sarah Jägers durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Wie verändern sich Räume und Rollen in der Pandemie? Wie wirken sich Kontaktverbote auf den privaten und den öffentlichen Raum aus? „Wie gehen die Menschen damit um, dass der Gottesdienst mit Hilfe des Computers am heimischen Küchentisch und nicht in der Kirche gefeiert wird?“, fragt Sarah Jäger. Im nächsten Jahr möchte sie dazu mit anderen eine Herbstschule anbieten. „Refiguration von Räumen und Rollen in der Corona-Pandemie“, so lautet der Arbeitstitel. Nachdenken und Diskutieren möchte Prof. Jäger darüber mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fächer, sie bahnt aktuell interdisziplinäre Kooperationen an. Die Voraussetzungen seien dazu an der Friedrich-Schiller-Universität hervorragend.
Die gebürtige Frankfurterin Sarah Jäger wuchs in einer reformierten Gemeinde auf. Die ausgeprägte Frömmigkeit habe in ihr schon früh den Wunsch geweckt, Theologie zu studieren und Pfarrerin zu werden, sagt die 35-Jährige. Dank eines Stipendiums des Evangelischen Studienwerkes Villigst konnte sie Evangelische Theologie studieren in Neuendettelsau, Tübingen, Berlin und Hermannstadt (Sibiu) in Rumänien. Die Möglichkeiten des freien Denkens hätten sie während ihres Studiums fasziniert, sagt Prof. Jäger, die als Erste ihrer Familie eine akademische Laufbahn einschlug. So sei der Wunsch gereift, eine Promotion anzustreben. Ihre Dissertationsschrift von 2017 trägt den Titel „Bundesdeutscher Protestantismus und Geschlechterdiskurse 1949-1971“. Sie entstand bei Prof. Dr. Reiner Anselm zunächst in Göttingen und wurde in München fertiggestellt. Ihre Dissertation wurde 2020 mit dem Hanna-Jursch-Preis der Evangelischen Kirche in Deutschland ausgezeichnet.
Von München wechselte Jäger nach Heidelberg, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft FEST arbeitete. Bevor sie dem Ruf an die Friedrich-Schiller-Universität Jena folgte, arbeitete Sarah Jäger am Lehrstuhl für Diakoniewissenschaft und Systematische Theologie/Ethik der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel.
Sarah Jäger ist verheiratet und hat einen anderthalbjährigen Sohn. Viel Freizeit bleibt der 35-Jährigen daher nicht, doch sie liest gern und gern mal drei Bücher gleichzeitig. Zu ihren Favoriten gehören Doris Lessing, Sándor Márai und Thomas Mann. Aktuell liest sie „Mein Name ist Luz“ der argentinischen Autorin Elsa Osorio. Das Ankommen in Jena mitten in der Corona-Pandemie sei nicht einfach gewesen, sagt Sarah Jäger. Inzwischen hat sie begonnen, sich in ihrer Kirchgemeinde in Jena-Nord zu engagieren, weil Glaube und Spiritualität in ihrem Leben eine große Rolle spielen, wie sie sagt. Außerdem gelte es, nach und nach die Stadt und ihre Möglichkeiten zu entdecken.
-
Andriy Khobta
Andriy Khobta
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse des Menschen. Doch enthalten die verzehrten Speisen neben Nährstoffen auch zahlreiche Substanzen, die in Zellen unseres Körpers schädliche Prozesse auslösen. Diese können schleichend und versteckt ablaufen und – anders als bei akuten Vergiftungen – lange unbemerkt bleiben, was sie umso gefährlicher macht. Die schädlichen Wirkungen von Lebensmitteln und ihrer Inhaltsstoffe zu untersuchen, das ist ein Aufgabengebiet der Ernährungstoxikologie. Die Folgen solcher Schäden, die ernährungsbedingt an unserem Erbgut, der DNA, entstehen, untersucht Dr. Andriy Khobta, neuer Professor für Ernährungstoxikologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
In Lebensmitteln enthaltene Stoffe können im Körper zu genotoxischen Metaboliten umgewandelt werden: zu chemischen Stoffwechselprodukten, die auf das Erbgut schädlich wirken. „Die induzierten Schäden an der DNA können zu Mutationen führen, d. h. zu irreversiblen Veränderungen der Nukleotidsequenz von Genen“, erklärt der Wissenschaftler ukrainischer Herkunft. „Diese machen sich aber nicht sofort, sondern meistens erst nach Jahrzehnten bemerkbar. Allmählich werden durch die Ansammlung von Mutationen mehrere kritische Gene betroffen, was die Eigenschaften der Zellen auf gefährliche Weise verändert. Erst dann entsteht eine Erkrankung“, fährt der Jenaer Ernährungstoxikologe fort. Die wohl bekannteste Erkrankung dieser Art ist Krebs. Gegenwärtig wird nahezu jeder vierte Todesfall in Deutschland durch Krebs verursacht. Die Forschung auf diesem Feld sei besonders wichtig, zumal ein Großteil der durch Genschäden verursachten Krankheitsfälle vermeidbar sei. „Wir versuchen herauszufinden, was die Gründe für die Mutationen sind und welche Rolle insbesondere die ernährungsbezogenen Faktoren dabei spielen.“
Ein besonderes Augenmerk seiner Forschung legt Khobta auf die DNA-Reparatur. Zellen unseres Körpers sind in der Lage, die beschädigte DNA, zumindest teilweise, zu reparieren. Aber welche DNA-Reparaturwege werden je nach Art der Schäden genommen und ist die Reparatureffizienz zwischen den Menschen verschieden? Diesen Fragen geht Khobtas Team mit einer besonderen Forschungsmethode nach.
Um DNA-Schäden und ihre Folgen in Zusammenhang zu bringen, verwenden die Jenaer Wissenschaftler DNA-Abschnitte mit synthetischen „Bausteinen“, welche die durch Fremdstoffe hervorgerufenen Schäden genau nachbilden. Solche synthetischen Schäden werden gezielt in ein genetisches Element bakteriellen Ursprungs eingefügt, das in der Lage ist, ein Reportergen in menschliche Zellen zu übertragen. „Der große Vorteil eines solchen Verfahrens gegenüber den herkömmlichen gentoxikologischen Testmethoden ist, dass sowohl die Struktur als auch die Position der geschädigten Stelle genau definiert sind. So werden die in Humanzellen entstehenden Mutationen nicht nur direkt ermittelt, sondern auch eindeutig der spezifischen Art des Schadens zugeordnet“, so Khobta.
Seine Forschungsergebnisse lässt Khobta auch in seine Lehre einfließen. Den Fokus setzt er dabei auf die molekularen Wirkmechanismen von Fremdstoffen. „Alle biologischen Wirkungen beruhen auf Interaktionen der Substanzen mit spezifischen Zielmolekülen im Körper“, erläutert der Toxikologe, der zuvor an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz tätig war. „Angesichts der enormen Komplexität der möglichen Effekte ist es besonders wichtig zu erkennen, welche Zielmoleküle und Signalwege für die Entstehung von Schäden an Zellen und Organen entscheidend sind. Ich strebe danach, die Studierenden anzuregen, die wichtigsten molekularen Zusammenhänge zu erfassen, die die biologischen Folgen bestimmen.“ Dies will der Dozent mit einer problemorientierten und interaktiven Lehre der Ernährungstoxikologie erreichen.
(Busse)
-
Nele Kuhlmann
Nele Kuhlmann
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Was lässt sich unter anerkennendem pädagogischen Handeln verstehen? Und welchen Problemen begegnen Pädagoginnen und Pädagogen, wenn sie anerkennend handeln wollen? Diesen Fragen geht Prof. Dr. Nele Kuhlmann nach. Sie hat in diesem Jahr die Tenure-Track-Professur Allgemeine/Systematische Erziehungswissenschaft am Institut für Erziehungswissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität übernommen. Im Fokus ihrer Lehre stehen Ansätze pädagogischer Ethik sowie grundbegriffliche Überlegungen zu Erziehung, Bildung und Sozialisation.
So konzentriert sich Nele Kuhlmann besonders auf die Ethik pädagogischen Handelns. „Mich interessiert dabei, wie eine Person pädagogische Verantwortung übernehmen kann, ohne dabei die Eigenverantwortung des Kindes oder der jugendlichen Person zu unterbinden“, erklärt die Wissenschaftlerin das Themenfeld. Dabei stehen Pädagoginnen und Pädagogen vor dem Problem, dass sie zum einen Freiräume für verantwortliches Handeln von Kindern schaffen sollen, zum anderen aber weiterhin in der Verantwortung für das Handeln der Kinder stehen. Diese verschränkte Verantwortung kennzeichnet Ansätze der pädagogischen Ethik.
Diesen Fragen geht Kuhlmann unter anderem in der qualitativen Schulforschung nach. Anhand von Videos aus dem Unterricht, zum Beispiel, wenn Schülerinnen und Schüler den Unterricht bewerten, untersucht sie, wie kommuniziert wird und wie Schülerinnen und Schüler in pädagogischen Handlungen, etwa bei Lob oder Prüfungen im Unterricht, adressiert werden. „Häufig verläuft die Unterrichtskommunikation nach eingeübten Mustern und offene Situationen oder Konflikte werden schnell wieder in diese Muster überführt“, so die Erziehungswissenschaftlerin. In ihren Vorlesungen und Seminaren analysiert sie gemeinsam mit den Studierenden anhand solcher praktischer Fälle, wodurch sich pädagogische Interaktionen auszeichnen, welche strukturellen Probleme sich dabei ergeben können und auch, wie Lehrende in der Situation anders agieren könnten. „Es geht dabei nicht darum, Rezepte für richtiges Handeln zu erlernen, sondern vielmehr ein Gefühl für pädagogische Situationen zu entwickeln, um diese gewissermaßen lesen zu können“, so die 32-Jährige.
Ausgehend von ihrer qualitativen Anerkennungsforschung argumentiert Nele Kuhlmann, dass sich pädagogische Tätigkeiten durch Spannungen auszeichnen, die nicht einfach aufzulösen sind. Den reflektierenden Blick von außen auf das pädagogische Handeln möchte sie deshalb ihren Studierenden mit auf den Weg geben. „Mein Ziel ist es, den Studierenden einen pädagogischen Takt zu vermitteln. Sie sollen ein Gefühl für soziale Situationen sowie ein Gespür für ihr Handeln und dessen Folgen entwickeln.“ Gemeinsam mit ihrem Kollegen Prof. Dr. Nils Berkemeyer möchte sie diese qualitative Anerkennungsforschung auch außerhalb der Wissenschaft nutzbar machen und beispielsweise Schulen in ihren Entwicklungsprozessen damit begleiten.
Neben ihrem Schwerpunkt zeichnet die Erziehungswissenschaftlerin auch ihre Forschungsmethode aus. Die Verbindung von Grundlagentheorie und einer fallbezogenen qualitativ-empirischer Forschung ist in der Erziehungswissenschaft bisher wenig verbreitet. Durch diese Art der Forschung ermöglicht sie den Studierenden, strukturelle Probleme des pädagogischen Handelns sichtbar zu machen und reflexiv zu bearbeiten.
„Die Universität Jena spielte besonders für die Entwicklung der Erziehungswissenschaft eine große Rolle und bietet gerade deshalb aus allgemein-pädagogischer Perspektive ein sehr spannendes Umfeld“, begründet die Juniorprofessorin, warum sie an die Friedrich-Schiller-Universität wechselte. „Auch die aktuellen Arbeiten am Institut sind für mich sehr anschlussfähig, da Fragen von Inklusion, Anerkennung und Partizipation aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet werden.“ Zudem sei das Förderprogramm für Tenure-Track-Professuren an der Universität Jena exzellent, so die gebürtige Bielefelderin, die zuletzt als akademische Rätin an der Universität Bayreuth tätig war und im vergangenen Jahr außerdem ihre Dissertation mit „summa cum laude“ an der Ruhr-Universität Bochum abschloss.
(Busse)
-
Anja Laukötter
Anja Laukötter
Foto: Anne Günther (Universität Jena)„Wissenschaft hat in Jena eine bedeutende Rolle in der Stadt. Ihre Wertschätzung ist großartig und vorbildhaft“, beschreibt Prof. Dr. Anja Laukötter ihren ersten Eindruck von der Stadt. Sie ist neue Professorin für Kulturgeschichte am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ein Schwerpunkt dieser Professur umfasst das Museum/Museumsstudien. Die gebürtige Westfälin freut sich darauf, die Zusammenarbeit zwischen universitärer Lehre und Forschung und der Öffentlichkeit weiter auszubauen.
Mit ihren breit gefächerten Forschungsschwerpunkten, die sich von der Geschichte des Wissens und der Wissenschaften, der Emotionsgeschichte, der Geschichte des Sammelns und der Sammlungen bis hin zur Medien- und Körpergeschichte sowie der Geschichte des (Post-) Kolonialismus erstrecken, bereichert Anja Laukötter das Themenspektrum am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften der Universität Jena. Ihren Fokus auf das 19. und 20. Jahrhundert will sie auch in Jena fortführen und die Forschung zu diesen Themengebieten zukünftig weiter prägen.
Besonders die Einbindung der über 40 wissenschaftlichen Sammlungen der Universität in die Lehre und für die Öffentlichkeit liegen der Wissenschaftlerin am Herzen. Neben der Beschäftigung mit der Historizität der Sammlungen möchte sie auch mit Museen und weiteren kulturellen Einrichtungen in Thüringen zusammenarbeiten. „Ich möchte Brücken schlagen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Die Sammlungen bieten großes Potenzial, beide Welten stärker miteinander zu verbinden.“
Besonders interessant ist für sie die aktuelle Forschung zu Kolonialismus und dessen Erbe. Dafür bietet ihr zum Beispiel die Alphons-Stübel-Sammlung für Orientfotografie der Universität Jena einen guten Ausgangspunkt. „Anhand dieser und anderer Sammlungen und ihrer Objekte der Universität können wir grundlegende Fragen der Kulturgeschichte sowohl inhaltlicher als auch in methodischer Art stellen“, erklärt sie. Drängend seien gerade bei dieser Art Material die Fragen, woher die Objekte stammen, warum und wie sie gesammelt wurden und welches Wissen darauf generiert wurde – sowohl in ihrer ursprünglichen Umgebung als auch heute als Teil der Wissenschaft.
Vor allem die verschiedenen Blickwinkel auf die Kulturgeschichte begeistern Laukötter. „Einerseits arbeiten wir in der Kulturgeschichte dicht an lokalen und nationalen Phänomenen. Gleichzeitig gilt es aber, auch größere, globale Strukturen und Prozesse einzubeziehen, Phänomene darin einzuordnen und zu verstehen“, erklärt sie die Mikro- und Makroperspektive auf das Wissenschaftsfeld. Dazu gehört auch das vergleichende und transnationale Arbeiten. So sollen Studierende der Kulturgeschichte lernen, die Themen und Phänomene sowohl im Deutsch-deutschen Vergleich, als auch im europäischen oder transnationalen Vergleich einzuordnen.
Darüber hinaus engagiert sich die Kulturhistorikerin für interdisziplinäres Arbeiten und versucht in ihren Projekten, Geistes- und Naturwissenschaften stärker miteinander zu verbinden. Sammlungen wie die des Phyletischen Museums oder die Botanische Lehrsammlung der Friedrich-Schiller-Universität bieten sich dafür besonders gut an.
Busse
-
Sina Leipold
Sina Leipold
Foto: André Künzelmann / UFZJede sinnstiftende Erzählung braucht eine klare Zukunftsperspektive mit plausiblen Handlungsanweisungen – das macht ein gutes Narrativ aus. Je klarer ein solches Narrativ ist, umso mehr Menschen lassen sich beispielsweise überzeugen, politische Maßnahmen für mehr Klimaschutz mitzutragen. Mit welchen Narrativen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine Transformation hin zu einer klügeren und nachhaltigeren Ressourcensteuerung auf den Weg bringen, ist einer der Schwerpunkte, die sich die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Sina Leipold für ihre Forschung gesetzt hat. Sie leitet seit September das Department Umweltpolitik am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und wurde gemeinsam mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen.
Nachhaltigkeitsnarrativen hat sich Sina Leipold bereits an der Universität Freiburg gewidmet, wo sie zwischen 2017 und Sommer 2021 Juniorprofessorin war und die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Nachwuchsforschungsgruppe „Circulus – Transformationspfade und -hindernisse zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in der Bioökonomie“ leitete. Die Forschungsarbeiten zielten darauf ab, ein Verständnis für die Entstehung und die möglichen Wege einer Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Die Ergebnisse geben Anregungen, wie neue Narrative gestützt sowie Monitoring- und Steuerungsinstrumente entworfen werden können, um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. „Das ursprüngliche Narrativ der Kreislaufwirtschaft, dass wir technische Lösungen einsetzen sollten, um die Effizienz zu steigern, war wirkungsvoll“, bilanziert Sina Leipold, die das unter anderem am Beispiel des 2019 in Kraft getretenen deutschen Verpackungsgesetzes untersuchte. Gleichzeitig seien aber viele Stakeholder der Kreislaufwirtschaft nicht zufrieden gewesen, weil sich nichts Wesentliches verändert habe. „Es gibt eben nicht nur das eine Effizienz-Narrativ, sondern auch ein neues, nämlich, dass es einen grundsätzlichen Systemwechsel braucht“, sagt sie. Das gibt ganz andere Handlungsanweisungen vor als Effizienzsteigerung, wie zum Beispiel, den Materialeinsatz zu reduzieren, Materialien nicht wegzuschmeißen, sondern zu reparieren oder wiederzuverwenden, sowie eine stärkere Kultur des Teilens von Gütern mit den Mitmenschen.
Am UFZ will Sina Leipold ihre inter- und transdisziplinäre Forschung zu den politischen Narrativen ausbauen. „Ziel ist, erfolgreiche Strategien zu identifizieren, wie Narrative verändert werden können“, sagt sie. Hierzu will sie beispielsweise bestehende Erkenntnisse zu Umwelt-Narrativen sammeln und empirisch testen. Zudem will die Umweltpolitologin herausfinden, wie Modelle, Szenarien und Indikatoren helfen können, Narrative für die Nachhaltigkeitstransformation zu stützen. „Interessant wäre es beispielsweise zu prüfen, was Konzepte wie der ökologische Fußabdruck wirklich bringen und welche Alternativen an narrativen und politischen Wirkmechanismen möglich sind, um etwa den Konsum von Lebensmitteln oder den Verbrauch von Verpackungen zu verändern“, sagt sie. Es gebe immer noch sehr viele politische Instrumente, die von theoretischen Annahmen über die Umweltwirkung ausgehen, aber noch nicht vollständig überprüft wurden und womöglich gar nicht die Effekte bringen, die man sich eigentlich erhofft hat.
Wichtig ist für die Umweltpolitologin die Praxisrelevanz ihrer Forschung. Ihr Freiburger Team verglich zum Beispiel die Umweltwirkungen von einem PET-Obstkörbchen und einem Wellpappe-Körbchen mit Klarsichtfolie. Im Ergebnis könnte der CO2-Fußabdruck bis zu 34 Prozent reduziert werden, wenn alle in Deutschland verkauften Obstkörbchen aus Wellpappe hergestellt würden. Doch da dafür Pappe und Papier hergestellt, transportiert und recycelt werden, schmilzt das Einsparpotenzial rasch dahin, wenn der Verbrauch insgesamt nicht gesenkt wird. „Das ist ein echter Rebound-Effekt: Die Sachen werden besser recycelt, man hat mehr zur Verfügung und die Leute konsumieren es umso mehr, so dass die Abfallmengen im Endeffekt jedes Jahr wachsen“, sagt sie. Ihre Forschung soll anwendungsbezogen sein, damit Politik, Wirtschaft oder die Gesellschaft die Ergebnisse auch umsetzen können. „Wir wollen Alternativen aufzeigen und Probleme der Umweltwirkungen von verschiedenen Narrativen diskutieren.“ Ergebnisse etwa zum Verpackungsgesetz in die breitere Öffentlichkeit zu kommunizieren, wie sie das z.B. in der TV-Sendung „Planet Wissen“ oder in einer Online-Diskussionsrunde mit der Bundesbildungsministerin tat, ist ihr obendrein ein wichtiges Anliegen: „Ich habe das Gefühl, dass es derzeit insbesondere unter den jüngeren Menschen in der Bevölkerung ein starkes Interesse für Umweltpolitik gibt. Das sollten wir aufgreifen“.
Für ihre herausragende Forschung, die sich durch eine hohe Politik- und Praxisrelevanz auszeichnet, wird Sina Leipold am 15. November mit dem Albert-Bürklin-Preis 2021 ausgezeichnet. Das gab das Kuratorium der Wissenschaftlichen Gesellschaft Freiburg am 04. Oktober 2021 in einer Pressemitteilung bekannt.
Sina Leipold, 1985 im thüringischen Sonneberg geboren, studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, der Jawaharlal Nehru University in New Delhi, der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) in Buenos Aires. Sie promovierte 2016 an der Universität Freiburg zur Einflussnahme von Interessensgruppen auf Narrative der internationalen Waldpolitik. Zwischen 2017 und 2021 war sie Juniorprofessorin an der Universität Freiburg und leitete die vom BMBF mit 2 Millionen Euro geförderte Nachwuchsforschungsgruppe zur „Circular Bio-Economy“. Sina Leipold war Gastwissenschaftlerin an der Yale University, der University of Technology Sydney, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Jawaharlal Nehru University New Delhi. Zum 1. September 2021 wurde sie gemeinsam von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem UFZ auf die Professur für Umweltpolitik berufen. Am UFZ leitet sie das gleichnamige Department.
(Susanne Hufe )
-
Roland Maier
Roland Maier
Foto: Jürgen Scheere (Universität Jena)Studierende für Mathematik und die damit verbundenen Anwendungen zu begeistern, das ist das Ziel von Roland Maier. Der neue Juniorprofessor für Numerische Mathematik der Friedrich-Schiller-Universität Jena will dazu die Studierenden mit seiner Lehre auf Augenhöhe erreichen.
In seiner Lehrveranstaltung zu den Grundlagen der Numerischen Mathematik möchte der 28-Jährige seine Studierenden von seinem Fach überzeugen. „Wenn man Begeisterung hat für das, was man tut, dann macht es auch viel mehr Spaß und es fällt einem leichter“, so der Ansatz von Roland Maier. „In Deutschland ist die Hemmschwelle seitens der Studierenden leider manchmal sehr hoch, mit den Lehrenden in Kontakt zu treten“, sagt er. Das sei schade, weshalb er besonderen Wert darauf lege, dass seine Tür für die Studierenden jederzeit offen steht. Damit hat der Wissenschaftler bereits während seiner Forschungstätigkeit an der Technischen Hochschule Chalmers und der Universität Göteborg in Schweden positive Erfahrungen gemacht.
Auch mit praktischen Anwendungen und möglichen Arbeitsbereichen versucht Maier die Studierenden für Mathematik zu begeistern. Denn die Verfahren der Numerischen Mathematik werden vielfältig eingesetzt – von Suchalgorithmen im Internet bis hin zu Simulationen, etwa in der Automobil-Industrie. Aber nicht alle Mathematikstudierenden schlagen nach ihrem Abschluss den Weg in die Praxis ein. Manche möchten auch in der Forschung arbeiten. Deshalb will Maier zukünftig Veranstaltungen zu aktuellen Forschungsthemen anbieten, die sich insbesondere an Masterstudierende richten, die den Einstieg in die Wissenschaft und Forschung suchen.
Bei seinen eigenen Forschungstätigkeiten motiviert Roland Maier besonders das gemeinsame Knobeln mit Kolleginnen und Kollegen zu verschiedensten mathematischen Problemen. Da in der Numerischen Mathematik auch die praktische Umsetzung am Computer wichtig ist, können die Forschenden ihre theoretischen Überlegungen zudem algorithmisch prüfen und bei Unstimmigkeiten gezielt auf Fehlersuche gehen – sowohl in der Theorie als auch in der Programmierung. Ziel seiner Forschung im Bereich der Numerischen Mathematik ist es, Methoden zu entwickeln, die mit möglichst wenig Rechenaufwand möglichst genaue Approximationen, also Annäherungen, an die Lösungen partieller Differentialgleichungen ermöglichen. Partielle Differentialgleichungen beschreiben die verschiedensten physikalischen Phänomene, ihre Lösungen können allerdings in der Regel nicht explizit angegeben werden. Die Numerische Mathematik beschäftigt sich mit der Entwicklung von Verfahren, die Näherungslösungen für solche Gleichungen berechnen. Dazu reduzieren Mathematiker wie Roland Maier die Lösung einer Gleichung in geeigneter Weise auf endlich viele freie Parameter (Diskretisierung).
Besonders fokussiert sich Roland Maier auf Multiskalenprobleme. Dabei geht es um die Berechnung physikalischer Probleme, die durch Informationen auf verschiedenen Skalen charakterisiert sind, z. B. auf Millimeter- und Meterskalen. Dies betrifft z. B. Verbundstoffe. Die Eigenschaften solcher Materialien hängen von Einflüssen auf Millimeter-, Zentimeter- und Meterskalen ab. Von Interesse bei der Berechnung sind oft nur Effekte auf groben Skalen, wobei die feinen Skalen aber nicht vernachlässigt werden dürfen. In solchen Fällen kommen spezielle Verfahren zum Einsatz, die auf die Problematik zugeschnitten sind. Dazu wird die Berechnung in mehrere unabhängige Teilprobleme aufgeteilt. Der Mathematiker ist speziell an solchen Multiskalenproblemen interessiert, die vom Ort und der Zeit abhängen. Als Beispiel nennt Maier hierfür Wellenbewegungen in Materialien, welche durch äußere Einflüsse im Laufe der Zeit ihre Eigenschaften ändern. Bereits während seiner Promotion an der Universität Augsburg beschäftigte sich Roland Maier mit einem weiteren Forschungsschwerpunkt im Kontext von gekoppelten Differentialgleichungen. Dabei sind Gleichungen für verschiedene Funktionen miteinander verbunden. Er entwickelt geeignete Diskretisierungsmethoden zur Aufsplittung solcher gekoppelter Differentialgleichungen, so dass diese entkoppeln und Näherungslösungen daher in kürzerer Rechenzeit berechnet werden können. Seine Forschungsarbeit wurde unter anderem von der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) als eine der besten Promotionsarbeiten 2020 ausgezeichnet.
Vivien Busse
-
Stefanie Middendorf
Stefanie Middendorf
Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Welchen Stellenwert hat der oder die Einzelne in einer Gesellschaft, in einem politischen System? Wie schwer war es beispielsweise in der NS-Zeit, Mensch zu bleiben, menschlich zu handeln? Fragen wie diesen geht Prof. Dr. Stefanie Middendorf nach. Die Zeithistorikerin lehrt und forscht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo sie den renommierten Lehrstuhl für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte übernommen hat. Es gehöre zu ihren Forschungsschwerpunkten, zu ergründen, wie sich Menschen in Zeiten von Krieg oder Krisen verhalten, sagt Stefanie Middendorf. Für diese Frage sei es zunächst nicht entscheidend, ob die Krise eine Demokratie oder eine Diktatur betrifft.
Stefanie Middendorf hat sich intensiv mit der Geschichte des Reichsfinanzministeriums nach dem Ersten Weltkrieg befasst. „Es ist spannend zu sehen, welchen Einfluss einzelne Akteure innerhalb des Apparates auf dessen Arbeit nahmen“, sagt sie. So hätten Beamte des Ministeriums – gemeinhin als Rädchen im Getriebe wahrgenommen – der Politik ganz konkrete Handlungsspielräume eröffnet, hätten so selbst staatspolitische Macht gewonnen. Erforschen wollte sie das in zwei politischen Systemen, weshalb Prof. Middendorf für ihre Habilitation den Zeitraum von 1919 bis 1945 in den Blick genommen hat. So konnte sie herausfinden, welche Einstellungen zu Staatswesen, Ökonomie und Politik die Beamten in der Weimarer Republik und im nationalsozialistischen Regime hatten und wie diese Einstellungen, angesichts der damaligen Ausnahmezustände, gesellschaftlich prägend wurden. Interessant sei dabei auch der vergleichende Blick in die Gegenwart, die ebenso in der Krise um gesellschaftliche Gewissheiten und „den Staat“ streite, konstatiert Stefanie Middendorf.
Das Ökonomische ist ein wichtiger Denkrahmen für die 48-jährige Zeithistorikerin. Aktuell leitet sie ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Forschungsnetzwerk, das untersucht, wie Staatsschulden historisch „gemacht“ wurden. Zudem arbeitet sie in einer Forschungsgruppe, die sich mit der Geschichte des Bundesministeriums der Finanzen seit 1945 befasst. „Mein Plan ist es, eine Kulturgeschichte des Kredits im langen 20. Jahrhundert zu schreiben“, sagt sie. Sei doch Schuldenmachen in Krisenzeiten nicht nur eine Sache des Staates, sondern eine zutiefst menschliche Angelegenheit.
Stefanie Middendorf ging in Oldenburg zur Schule, studierte in Freiburg/Br. und Basel Geschichte, Germanistik, Psychologie und Kunstgeschichte. Im Rahmen ihrer Promotion 2008 in Freiburg erkundete sie den Wandel der kulturellen Moderne in Frankreich in den Jahren nach 1880 und forschte dafür einige Zeit in Paris. In der kulturhistorischen Arbeit ging es um Phänomene wie das Kino oder neue Medien. Während des Studiums verbrachte sie zudem ein Jahr als Graduate Fellow an der Hebrew University Jerusalem.
In Jena habe sie tolle, engagierte Studentinnen und Studenten vorgefunden, eine hohe Lektürebereitschaft und Diskussionsfreude. Rückmeldungen der Studierenden geben ihr wichtige Impulse für die eigene Arbeit, sagt Stefanie Middendorf. So gelte es immer wieder, gemeinsam über Begriffe und Methoden zu reflektieren, auch über theoretische Fragen nachzudenken. Heiße historische Forschung doch, die Vergangenheit wieder und wieder durch die Linse der Gegenwart zu betrachten. Dies gelte gerade für die Geschichte des Nationalsozialismus, ein bleibendes Thema in Forschung und Lehre: „Heute stellen wir andere Fragen an die NS-Zeit als noch vor 30 Jahren.“ Gleichzeitig sei es wichtig, die nationalsozialistische Herrschaft nicht als ein aus der Zeit gefallenes Phänomen zu sehen, Kontinuitäten und Brüche in den Blick zu nehmen und diese Vergangenheit so immer wieder neu in die Zeitgeschichte – Geschichte der Gegenwart – hineinzudenken. Wichtig sei ihr zudem ein interdisziplinärer Ansatz in der Geschichtswissenschaft.
Wertvolle Erfahrungen hat sie nach ihrer Promotion im Kulturinstitut der Stadt Braunschweig gesammelt. In der gemeinsamen Arbeit von Personen, Vereinen, Museen, Verbänden, Universität und Stadt entstand eine virtuelle Stadtkarte der Erinnerung, das „Vernetzte Gedächtnis“. An diese Arbeit möchte Prof. Middendorf in Jena anknüpfen. Erste Kontakte etwa zum Stadtmuseum oder zum Thüringer Archiv für Zeitgeschichte hat sie bereits geknüpft.
Stefanie Middendorf lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Berlin. In ihrer Freizeit interessiert sie sich für Kunst und Reisen – viel Zeit bleibt dafür jedoch nicht.
Stefan Laudien
-
Sven Möbius-Winkler
Sven Möbius-Winkler
Foto: Michael Szabó/UKJBei Belastung auftretendes Engegefühl oder Schmerzen in der Brust – das sind die klassischen Anzeichen für eine koronare Herzerkrankung, die jeden vierten Mann über 75 betrifft. Ursache sind Ablagerungen und Verengungen in den Herzkranzgefäßen. Behandelt wird die Erkrankung mit Medikamenten, durch eine Erweiterung der Engstellen bei einem Herzkathetereingriff oder eine Bypassoperation. Zur Diagnose und eben auch zur Therapie erfolgt eine Untersuchung im Herzkatheterlabor, bei der ein dünner Schlauch über eine große Körperader unter Röntgenkontrolle bis ins Herz vorgeschoben wird. Das ist das tägliche Geschäft von Prof. Dr. Sven Möbius-Winkler, der als leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor in der Klinik für Innere Medizin I am Universitätsklinikum Jena (UKJ) arbeitet. Seit Dezember hat der 50-jährige Kardiologe die neu eingerichtete Professur für Invasive Kardiale Funktionsdiagnostik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne.
„Um beispielsweise zu entscheiden, ob eine Engstelle im Herzkranzgefäß für die Beschwerden verantwortlich ist, können wir im Herzkatheter die Gefäßfunktion vor Ort untersuchen“, schildert Sven Möbius-Winkler die Möglichkeiten der modernen Kardiologie. Dazu zählen bildgebende Verfahren wie die Untersuchung der Gefäße mittels winziger Ultraschallsonden von innen oder die optische Kohärenz-Tomografie, mit der sich der Umfang und die Beschaffenheit von Ablagerungen im Gefäß beurteilen lassen. Sonden können die Blutdruckverhältnisse erfassen, Temperaturmessungen im Gefäß geben Auskunft über Entzündungsprozesse. Die Funktion kleinerer Gefäße wird über indirekte Parameter erfasst, zum Beispiel in der Reaktion auf eine durch Medikamente simulierte Belastungssituation. „Wir arbeiten an der Weiterentwicklung dieser diagnostischen Methoden, um die jeweils optimale Behandlung zu realisieren.“
Diese erfolgt oftmals auch im Katheterlabor – durch das Aufdehnen von Engstellen mittels Ballon oder das Einsetzen von Gefäßstützen, die die weitere Verengung verhindert sollen. Auch wenn Strukturen im Herz wie z. B. Herzklappen so verändert sind, dass ihre Funktion massiv eingeschränkt ist, kann die Behandlung oft minimalinvasiv mit einem Kathetereingriff durchgeführt werden. Diese Therapien sind ein weiterer Arbeitsschwerpunkt von Sven Möbius-Winkler. Im Rahmen dessen leitet er die multizentrische Clearance-Studie für Patienten mit Vorhofflimmern. Diese müssen zur Schlaganfall-Prävention Gerinnungshemmer nehmen, was jedoch die Gefahr für Blutungen erhöht. Prof. Möbius-Winkler: „Wir testen, ob solchen Patienten, die schon eine Hirnblutung erlitten haben, nicht durch eine Art Siebverschluss im Vorhofohr – dort entstehen oft die Gerinnsel, die dann einen Schlaganfall verursachen können – besser geholfen werden kann und die Gefahr der erneuten Blutung damit reduziert werden kann.“ In einer weiteren klinischen Studie in Kooperation mit der UKJ-Radiologie vergleicht der Kardiologe die Aussagekraft der invasiven Herzfunktionsdiagnostik bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung mit nichtinvasiven Verfahren.
Nach dem Medizinstudium in Leipzig absolvierte Sven Möbius-Winkler am Herzzentrum Leipzig die Facharztausbildung in der Inneren Medizin und zum Kardiologen. In seiner Dissertation verglich er bei Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung die Wirkung von körperlichem Ausdauertraining und Stentimplantation. 2012 übernahm er als Chefarzt die Kardiologie am Klinikum in Weißenfels und habilitierte sich im Jahr darauf an der Universität Leipzig mit dem Thema "Körperliche Aktivität als Grundpfeiler kardiovaskulärer Gesundheit." Seit 2016 arbeitet er am Universitätsklinikum Jena und konnte hier schon umfassende Erfahrungen als Lehrender im Jenaer neigungsorientierten Medizinstudium sammeln. Neben Vorlesungen im Kardioblock und in der Notfallmedizin bietet er Falldemonstrationen in der Linie Klinik-orientierte Medizin an – im Katheterlabor.
vdG
-
Martin Oschatz
Martin Oschatz
Foto: Anne Günther (Universität Jena)"Den Ausstoß von Kohlendioxid senken – das ist die wohl wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die Erderwärmung und damit gegen den Klimawandel. Um das Treibhausgas in zu großen Mengen aus der Atmosphäre herauszuhalten, gilt zum einen, weniger davon zu emittieren, und zum anderen, es dort, wo es ausgestoßen wird, aufzufangen. Wie das möglichst effizient – und sogar gewinnbringend – gelingen kann, erforscht der Chemiker Prof. Dr. Martin Oschatz seit Anfang 2021 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
„Wir entwickeln Kohlenstoff-Nanomaterialien, die CO2 etwa an Industrieanlagen oder direkt aus der Luft herausfiltern können“, erklärt Martin Oschatz einen seiner Forschungsschwerpunkte. „Wenn man berücksichtigt, dass der Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre bei rund 0,04 Prozent liegt, wird klar, wie herausfordernd es sein kann, gezielt nur dieses Spurengas zu adsorbieren.“ Dafür binden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Oschatz verschiedene Moleküle zu einem makroskopischen Objekt mit einer großen Oberfläche zusammen. „Vereinfacht gesagt gewinnen wir dabei beispielsweise einen Teelöffel schwarzes Pulver, das die Fläche eines halben Fußballfeldes einnehmen kann“, erklärt der 33-jährige Chemiker. „Schließlich beobachten wir genau, was an den Grenzflächen des Materials passiert, um zu verstehen, welche Mechanismen dazu beitragen, dass ein bestimmter Stoff – wie beispielsweise Kohlendioxid – andockt. So können wir für die entsprechenden Anwendungen gezielt Materialien maßschneidern.“
Das aufgefangene CO2 kann zum einen unterirdisch gespeichert werden, zum anderen dient es aber auch als wertvoller Rohstoff. Denn aus ihm lassen sich Grundchemikalien wie Methanol herstellen. „Nachhaltig ist das vor allem dann, wenn bei diesen Prozessen hauptsächlich erneuerbare Energien zum Einsatz kommen“, sagt Oschatz.
Um die umweltfreundliche Produktion eines klassischen Ausgangsstoffs für viele Anwendungen dreht es sich auch in einem weiteren Forschungsschwerpunkt des neuen Professors. „Seit rund 100 Jahren wird Ammoniak mit dem Haber-Bosch-Verfahren bei hohen Drücken synthetisiert, um es beispielsweise als wichtigen Bestandteil von Düngemitteln zu verwenden“, erklärt der Chemiker. „Dabei wird Wasserstoff, der durch Erhitzen von Erdgas abgespalten wird, mit Stickstoff verbunden – für beide Vorgänge sind hohe Temperaturen notwendig.“
Oschatz entwickelt Materialien für Katalysatoren, durch die diese Prozesse auch elektrochemisch bei Raumtemperatur stattfinden können. So kann der Energieeintrag durch elektrischen Strom erfolgen und so modifiziert werden, dass Wasserstoff auch durch die Aufspaltung von Wasser gewonnen werden kann – Wasserspaltung und Ammoniaksynthese könnten dann in einem Reaktor kombiniert werden.
Mit solchen Zukunftsthemen an der Schnittstelle zwischen der Herstellung von Nanomaterialien, Grenzflächenchemie und Energieanwendungen fühlt sich der neue Professor an der Friedrich-Schiller-Universität genau am richtigen Ort. „Ich habe mich für Jena entschieden, weil hier eine sehr gut funktionierende Forschungsinfrastruktur im Bereich Materialien und Energie existiert, die ich mit meiner Expertise in Synthese und Charakterisierung gut ergänzen kann. Jena gibt mir die Möglichkeit, Problemstellungen und offenen Fragen der Chemie der Energiematerialien aus verschiedensten Blickwinkeln zu begegnen. In Netzwerke, Forschungsverbünde und Sonderforschungsbereiche bin ich schnell proaktiv eingebunden worden“, sagt der gebürtige Radebeuler, der zuletzt am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam geforscht sowie an der Universität Potsdam gelehrt hat. Zuvor hatte er an der TU Dresden, im US-amerikanischen Atlanta und an der Universität Utrecht in den Niederlanden gearbeitet."
(Hollstein)
-
Adrian Tibor Press
Dr. Adrian Press
Foto: Michael Szabó/UKJ"Eindringende Krankheitserreger können eine so massive Immunantwort auslösen, dass die Abwehrreaktion den gesamten Körper erfasst und die Funktion ganzer Organe schädigt. Bei einer solchen Infektion, die lebensbedrohlich werden kann, ist die Leber als zentrales Stoffwechselorgan besonders gefordert. „Die Hepatozyten, die ‚Arbeitstiere‘ in der Leber, müssen dann nicht nur die von den Erregern produzierten Gifte abbauen, sie haben auch das Blut von all den Signalstoffen und Zerfallsprodukten zu entgiften, die die Immunzellen hinterlassen“, beschreibt Adrian Press den Arbeitsauftrag an die Leberzellen. Er erforscht auf molekularer Ebene, wie durch eine so schwere Infektionserkrankung die Stoffwechselmechanismen verändert sind und wie dadurch die Organfunktion gestört wird. Seit Februar ist der 32-jährige Wissenschaftler Juniorprofessor für Molekulare Medizin lebensbedrohlicher Infektionen am Universitätsklinikum Jena.
Nach seinem Bachelorstudium in Furtwangen absolvierte Adrian Press den Masterstudiengang Molekulare Medizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und promovierte anschließend am Universitätsklinikum Jena in einem Forschungsprojekt zur Entwicklung funktionalisierter Nanopartikel für den zellspezifischen Wirkstofftransport. Als PostDoc baute er eine eigene Arbeitsgruppe „Nanophysiologie“ an der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des UKJ auf und forschte als Gastwissenschaftler in Japan, Großbritannien und Schweden. Für die Juniorprofessur in Jena lehnte er das Angebot als Associate Professor an der Universität im chinesischen Hangzhou ab.
Seine Arbeitsgruppe kooperiert eng mit den Jenaer Gruppen in der Sepsis- und Mikrobiomforschung. „Wir untersuchen zum Beispiel, wie die Leber das Mikrobiom im Darm steuert und in Schach hält, oder wie schwere Infektionen in die Zelltodmechanismen der Hepatozyten eingreifen“, so Adrian Press. Der Molekularmediziner forscht auch an am medizinischen Einsatz von Nanopartikeln, die als „Taxis“ für Medikamente verwendet werden können und durch spezielle Oberflächeneigenschaften ihren Weg zum Zielort finden, um dort z. B. den Stoffwechsel der Zellen zu unterstützen. Dabei arbeitet Adrian Press mit modernsten biophotonischen Nachweis- und Bildgebungsmethoden: „Mithilfe zeitlich und räumlich hochauflösender Intravital-Mikroskopie gelingt es uns, den Weg von Stoffwechselprodukten im Gewebe nachzuvollziehen.“ Dieses Methodenwissen wird der Juniorprofessor weitergeben – in einem neuen Spezialisierungsmodul im Masterstudiengang Medical Photonics."
(vdG)
-
Jonas Sauer
Jonas Sauer
Foto: Jürgen Scheere (Universität Jena)Mit einer kreativen Idee für seine Lehre startete Prof. Dr. Jonas Sauer seine Tätigkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena: In einer „Literatur-Rundschau“ verbindet der neue Juniorprofessor (mit Tenure Track) für Analysis eine Lehrveranstaltung mit einer Podcast-Reihe. Im Dialog mit aktiven Forschenden bespricht Sauer Literatur zu ausgewählten Themen und zeigt Verläufe einzelner Forschungsprojekte auf. Damit gibt er Studierenden Beispiele an die Hand, die ihnen bei der Erarbeitung eigener Forschungsthemen im Seminar helfen sollen.
Insbesondere Masterstudierende möchte Sauer mit seiner Podcast-Reihe erreichen. In seinen Interviews befragt er Forschende aus dem Bereich Analysis zu ihrer Forschung, zeigt Wege auf, wie sie zu ihren Forschungsfragen gelangen und welche Netzwerke und Kontakte sie dabei nutzen. „Einerseits möchte ich die Studierenden motivieren und ihnen zeigen, dass Wissenschaft kein Hexenwerk ist. Andererseits möchte ich auch die Personen vorstellen, die die Studierenden sonst nur als Autoren von Literatur und Artikeln kennen“, sagt der 35-jährige Mathematiker, der zuvor als Assistenzprofessor an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden tätig war. Hinzu käme, dass gerade in Zeiten der COVID-19-Pandemie Konferenzen und Möglichkeiten des Austausches und des Kennenlernens sehr begrenzt wären. Die Erkenntnisse aus den Gesprächen sollen den Studierenden etwa beim Finden der Forschungsfrage für ihre Masterarbeiten helfen. Die Podcasts hat der Wissenschaftler zu Beginn seiner Tätigkeit in Jena ins Leben gerufen und gemeinsam mit dem Multimediazentrum der Universität umgesetzt. Zu finden sind die Podcastfolgen in der digitalen Bibliothek ThüringenExterner Link.
Wenn er nicht gerade Podcasts aufnimmt und sie mit seinen Studierenden bespricht, beschäftigt sich der Juniorprofessor mit partiellen Differentialgleichungen, kurz PDG. „Die partiellen Differentialgleichungen sind eigentlich die Sprache der Physik“, erläutert er. So ließen sich vor allem physikalische Phänomene mit solchen Differentialgleichungen darstellen. Aufgabe der Mathematik sei es, Lösungen für ihre Berechnung zu finden und anhand dieser die zugrundeliegenden Modelle zu verifizieren. Ein Beispiel für Sauers Forschung und Lehre sind Gleichungen aus dem Bereich der Fluiddynamik. Diese würden beispielsweise genutzt, um das Verhalten von Flüssigkeiten oder Gasen zu berechnen, so der Mathematiker.
Nachdem er sich im Studium und seiner Promotion an der Technischen Universität Darmstadt vor allem auf deterministische partielle Differentialgleichungen fokussiert hat, erweiterte Sauer seinen Forschungsschwerpunkt als Postdoc am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig im Bereich stochastischer, also vom Zufall geprägter, partieller Differentialgleichungen. „Die Theorie der deterministischen partiellen Differentialgleichung ist gut verstanden. Im Gegensatz dazu wird für stochastische PDG häufig mit ad hoc-Lösungen gearbeitet. Einen allgemein gültigen und anwendbaren Rahmen gibt es für diese Art der Gleichungen nicht.“ Jonas Sauer macht sich deshalb die verschiedenen Stationen seines Werdegangs zu Nutze, bei denen er sowohl mit deterministischen als auch mit stochastischen PDG intensiv gearbeitet hat. Er strebt an, die Methoden und Werkzeuge der deterministischen PDG auf die stochastischen PDG anzuwenden und damit für diesen Teilbereich den noch fehlenden übergreifenden Rahmen zu schaffen. „In Jena habe ich dafür ein bereicherndes Umfeld gefunden“, sagt der Mathematiker. Denn einer der Gründe, warum es ihn nach Jena gezogen hat, waren die Anknüpfungsmöglichkeiten seiner Forschung mit den Schwerpunkten der Kolleginnen und Kollegen am Institut für Mathematik der Universität Jena. Aber auch persönliche Erfahrungen überzeugten den zweifachen Familienvater, an die Universität in Jena zu wechseln. Sowohl seine Frau als auch sein Bruder studierten in der Stadt, so dass er diese bereits gut kennt und sich auch im Umfeld der Universität wohlfühlt.
Viven Busse
-
Indra Schröder
Indra Schröde
Foto: Michael Szabó/UKJAls „U-Boote des Wissens“ bezeichnete der Biochemiker Ernst-Ludwig Winnacker die Viren, weil sich an ihnen, reduziert auf das absolut Wesentliche, grundlegende Prozesse der Zellbiologie studieren lassen. In diesem Sinne nutzt Prof. Dr. Indra Schröder Ionenkanäle, die in Viren vorkommen, um daran die Struktur-Funktionsprinzipien dieser kleinsten Poren in den Zellmembranen zu untersuchen. Die 43-jährige Biophysikerin hat seit September eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Heisenberg-Professur für Biophysik der Ionenkanäle an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne und erklärt: „Ionenkanäle verknüpfen in unserem Körper chemische und elektrische Informationen und spielen damit eine Schlüsselrolle für Stoff- und Signaltransporte.“ Die detaillierte Kenntnis ihrer Funktion bietet wichtige Ansatzpunkte für das Verständnis von Krankheitsmechanismen.
Ionenkanäle sind Proteinmoleküle, die aus mehreren Untereinheiten aufgebaut sind; aufgrund elektrischer oder chemischer Signale ändert sich deren Struktur. Um den Virenkanälen und auch viel komplexer strukturierten, klinisch relevanten Kanalproteinen beim Öffnen und Schließen zuschauen zu können, nutzt die Wissenschaftlerin ausgefeilte elektrophysiologische Methoden, sie baut künstliche Zellmembranen und misst mit Mikrometer-feinen Elektroden den durch einen Kanal fließenden Strom. Eine besondere methodische Herausforderung für die Messungen ist die Geschwindigkeit des Schaltprozesses. „Wir erreichen im Idealfall eine Zeitauflösung bis in denen Nanosekundenbereich“, so die Professorin, „diese Messdaten ergänzen wir durch Zusammenarbeit mit theoretisch arbeitenden Gruppen, um aus deren moleküldynamische Simulationsrechnungen statistische Vorhersagen treffen zu können.“
Indra Schröder studierte Physik an der Universität Kiel und forschte bereits als Doktorandin am dortigen Institut für Angewandte Physik und Zentrum für Biochemie und Molekularbiologie an Ionenkanälen. Nach ihrer Promotion arbeitete sie als Postdoc an der TU Darmstadt und anderthalb Jahre lang an der Universität Mailand. In Darmstadt habilitierte sie sich mit der hochaufgelösten Analyse des Schaltverhaltens von Ionenkanälen für die Fächer Biophysik und Zellbiologie. An der TU Darmstadt leitete sie eine eigene Juniorarbeitsgruppe im Fachbereich Biologie.
Im vergangenen Jahr wurde Indra Schröder in das Heisenberg-Programm der DFG aufgenommen. Die bis zu fünfjährige Förderung ermöglicht ihr den Ausbau ihrer wissenschaftlich eigenständigen Arbeitsgruppe. Diese ist am Institut für Physiologie II des Universitätsklinikums angesiedelt, das schwerpunktmäßig an Ionenkanälen und Membranrezeptoren forscht. In der hier koordinierten DFG-Forschungsgruppe zur Dynamik von Ionenkanälen und Transportern leitet sie ein Teilprojekt. Als Heisenbergprofessorin hat Indra Schröder keine Lehrverpflichtung, wird sich aber am interfakultären Masterstudiengang Medical Photonics und an der Physiologielehre für Studierende im Nebenfach beteiligen. Für ihr Forschungsgebiet hat die Biophysikerin schon zu zahlreichen Arbeitsgruppen an Klinikum, Universität und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf dem Beutenberg Kontakte knüpfen können. „Ich freue mich, Teil des Jenaer Netzwerks im Bereich der Bio- und Medizinphotonik zu werden“, so Prof. Schröder.
(Uta von der Gönna )
-
Pierre Stallforth
Pierre Stallforth
Foto: Anna Schroll/Leibniz-HKIPierre Stallforth ist seit kurzem Professor für Bioorganische Chemie und Paläobiotechnologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zugleich baut er den weltweit neuartigen Forschungsbereich Paläobiotechnologie am Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (Leibniz-HKI) in Jena auf. Ziel seiner Forschung ist es, verschwundene Naturstoffe wiederherzustellen, die als Antibiotika gegen resistent gewordene Bakterien eingesetzt werden könnten. Ermöglicht wird das durch eine Förderung der Werner Siemens-Stiftung.
Pierre Stallforth hatte schon als Kind ein kleines Chemielabor im Keller seiner Eltern. Und auch wenn es das Kellerlabor mittlerweile nicht mehr gibt, ist seine Faszination für chemische Strukturen geblieben. „Antibiotika sind oft Naturstoffe mit einer sehr komplexen, dreidimensionalen Struktur“, erklärt Stallforth. „Ihre Architektur ist nicht vergleichbar mit einer kleinen Hütte, eher mit dem Buckingham-Palast.“
An der Antibiotika-Forschung fasziniert ihn unter anderem die Verbindung von Grundlagenforschung und relevanter Anwendung. Den wachsenden Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken ist eine der großen globalen Herausforderungen der kommenden Jahre. Gleichzeitig forschen Pharmaunternehmen so gut wie gar nicht an neuen Wirkstoffen, da es sich für sie finanziell nicht lohnt. „Neue Antibiotika sollten nur als Reserveantibiotika eingesetzt werden, damit sich nicht zu schnell neue Resistenzen gegen sie entwickeln“, erläutert Stallforth.
Nach dem Chemie-Studium in Oxford promovierte Pierre Stallforth an der ETH Zürich, wo er bakterielle Zuckerverbindungen für hitzeresistente Impfstoffe synthetisierte. Dort und in seinem Postdoktorat an der Harvard Medical School in Boston wuchs seine Faszination für die chemische Struktur von Naturstoffen. „Das Leibniz-HKI ist eines der wichtigsten Zentren für Naturstoff-Forschung. Da war es schon fast selbstverständlich, dorthin zu gehen“, sagt er. 2013 wurde er Leiter der Nachwuchsgruppe „Chemie Mikrobieller Kommunikation“. Um miteinander zu interagieren nutzen Mikroorganismen kleine Moleküle, einige davon sind antibiotisch wirksam. „Antibiotika sind ursprünglich nicht dazu da, Krankheiten zu heilen, sondern regeln das Zusammenleben von Bakterien und anderen Mikroben“, stellt Stallforth klar. „Wenn wir dieses Zusammenleben besser verstehen, können wir auch neue Antibiotika finden“.
Dafür suchen Forschende gerne an abgelegenen, wenig erforschten Orten – beispielsweise in Gegenden, in denen bisher noch selten Antibiotika eingesetzt wurden. Doch warum nicht auch an zeitlich abgelegenen Orten suchen? „Im Rahmen meiner Arbeit im Exzellenzcluster Balance of the Microverse habe ich die Archäologin Christina Warinner kennengelernt, die in prähistorischen Proben nach Resten von Bakterien sucht, vor allem im Zahnstein von Frühmenschen“, erzählt Stallforth. Warinner leitet die Forschungsgruppe Archäogenetik am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und ist Professorin an der Harvard University und an der Universität Jena.
„Ich fand die Möglichkeit interessant, diese Proben als Quelle für noch unentdeckte Naturstoffe zu nutzen“, so Stallforth. Die Moleküle der frühzeitlichen Bakterien könnten ganz andere Wirkweisen haben als die heutiger Mikroorganismen. „Bakterien können genauso aussterben wie der Säbelzahntiger“, erläutert Stallforth. Etwa durch gesellschaftliche Veränderungen, neue Essgewohnheiten oder in jüngerer Zeit eben durch Antibiotika. So lassen sich in den uralten Bakterien möglicherweise antibiotisch wirksame Naturstoffe finden, die von heutigen Mikroorganismen nicht mehr hergestellt werden.
Das Treffen stellte sich als ein Glücksfall heraus. Ein erstes gemeinsames Projekt zum Erbgut eines mittelalterlichen Skeletts verlief erfolgreich und Stallforth und Warinner sahen die Chance, Archäologie, Genetik, Chemie und Mikrobiologie viel stärker miteinander zu verbinden, als dies bislang der Fall war. Eine Förderung der Werner Siemens-Stiftung ermöglichte es ihnen dann, im Jahr 2020 mit dem Aufbau des weltweit neuartigen Forschungsbereichs Paläobiotechnologie zu beginnen. Warinner ist mit ihrer Gruppe mittlerweile ebenfalls am Leibniz-HKI assoziiert, beide Gruppen ziehen demnächst in das neue Biotech-Center des Instituts und können so noch enger kooperieren.
„Das ist ein unglaublich transdisziplinäres Projekt an der Schnittstelle zwischen Geistes- und Naturwissenschaften“, beschreibt Stallforth, was ihn an dem neuen Forschungsbereich fasziniert. Zugleich ermögliche ihm das Vorhaben, an der Front biotechnologischer Forschung tätig zu sein. „Wir nutzen die neuesten Sequenzier- und Synthesetechniken und sind an der Weiterentwicklung modernster bioinformatischer und molekularbiologischer Methoden beteiligt.“
Denn um neue Naturstoffe zu finden, müssen die Forschenden diese Information erst aus der Jahrtausende alten DNA der Bakterien extrahieren. Je älter die Proben sind, desto kleiner sind die noch erhaltenen DNA-Schnipsel. „Man kann sich das vorstellen wie ein Buch – wenn man einzelne Seiten hat, kann man das noch recht einfach zusammensetzen, bei einzelnen Wörtern wird es schwierig“, erklärt Stallforth diese bioinformatische Herausforderung. Um die riesigen Mengen an Proben und daraus extrahierten Daten zu bearbeiten, baut er mit Kolleginnen und Kollegen eine Robotik-Plattform auf, die Routine-Laboraufgaben künftig vollautomatisch in hohem Durchsatz erledigen soll.
Der Standort Jena mit seinen vielen verschiedenen Forschungsinstituten und der Universität sei für den Aufbau des neuen Forschungsbereichs ideal, so Stallforth. Über mehrere Forschungsverbünde ist er fest in die akademische Landschaft integriert. So ist er neben dem Exzellenzcluster Externer LinkBalance of the Microverse auch Mitglied des Sonderforschungsbereichs ChemBioSysExterner Link. „Ich habe hier außerdem ein ganz tolles Team, ohne das dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre“, sagt Stallforth. Besonders wichtig sei ihm der kollegiale Umgang und der kooperative wissenschaftliche Austausch zwischen allen Mitgliedern des Instituts. „Die Infrastruktur ist optimal für die Forschung, nicht nur was die Labore angeht, sondern auch die wissenschaftliche Koordination, die Administration und die vielen ‚guten Geister‘, vom Haustechniker bis zur Warenannahme.“
Den großen Wert interdisziplinärer Kooperation will Pierre Stallforth nun auch als Professor an die Studierenden weitergeben: „Längerfristig geht es auch darum, sich Gedanken zu machen, wie wir das Studium künftig gestalten. Neue Wege müssen gefunden werden, um künftige wissenschaftliche Fragen zu beantworten und die neue Generation Studierender auf die Herausforderungen in der Wissenschaft, Gesellschaft und dem Gesundheitswesen vorzubereiten.“
Ronja Münch
-
Daniel Streitz
Daniel Streitz
Foto: Fotowerk HalleWie wirken sich Finanzmarktentscheidungen auf reale Märkte aus? Wie genau lassen sich die Folgen finanzpolitischer Entscheidungen verstehen? Warum zeigen Entscheidungen manchmal unerwartete Wirkungen? Fragen wie diese faszinieren Prof. Dr. Daniel Streitz von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Das Spannende ist die Frage nach dem Wie und Was“, sagt der Professor für Finance, Law, and Regulation. Anders gesagt: Lässt sich der Mechanismus generalisieren, den die Forscher in einem speziellen Setting erkannt haben? Die Crux dabei sei, dass die Ökonomie eine Gesellschaftswissenschaft ist, in der Experimente wie in der Naturwissenschaft in der Regel nicht möglich sind. Es gelte also, nach den passenden realen Settings Ausschau zu halten, um möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.
Beispielsweise haben Daniel Streitz und Kollegen einen interessanten Nebeneffekt von unkonventioneller Geldpolitik, welche verstärkt seit der Finanzkrise Verwendung findet, beobachten können. Im Jahr 2016 hatte die Europäische Zentralbank mit dem Ziel einer weiteren geldpolitischen Lockerung erstmals begonnen, Unternehmensanleihen anzukaufen. Insbesondere große Unternehmen gaben daraufhin verstärkt Anleihen aus und reduzierten gleichzeitig ihre Bankkreditfinanzierung. Hierdurch wurde bei den Banken Kapital frei, das wiederum an kleinere, finanziell beschränktere Unternehmen ausgegeben werden konnte. „Während die realen Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit großer Unternehmen marginal waren, profitierten kleinere Unternehmen indirekt von diesem Eingriff der Zentralbank“, konstatiert Prof. Streitz. Für ihn als Wissenschaftler bestehe die Herausforderung darin, die genauen Zusammenhänge zu ergründen. Seien bei wirtschafts- und geldpolitischen Eingriffen doch negative Auswirkungen ebenso denkbar; unerwünschte Folgen, die es zu vermeiden gilt. Als Ansatzpunkt in der empirischen Analyse dient den Finanzwissenschaftlern beispielsweise ein Vorher-Nachher-Vergleich. Das heißt, die Entwicklung jener Unternehmen, die von einem Eingriff betroffen sind, wird verglichen mit der Entwicklung möglichst ähnlicher Unternehmen, die nicht betroffen sind. „In solchen Zusammenhängen sind Mikrodaten zu Firmen spannend, vor allem, wenn wir sie über mehrere Jahre auswerten können“, sagt Daniel Streitz.
Das Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge falle bei ihm mit dem Interesse für Politik zusammen, sagt Daniel Streitz. Hinzu komme ein Faible für Statistik und empirische Analysen. So habe sich nach dem Abitur in seiner Heimatstadt Hannover die Frage nach dem Studienfach gestellt. „Die Volkswirtschaftslehre verbindet meine Interessensgebiete hervorragend“, sagt Daniel Streitz. Der 38-Jährige studierte in Münster und schrieb in Berlin am Institut für Corporate Finance der Humboldt-Universität seine kumulative Dissertation. Das heißt, als Doktorarbeit wurden drei Fachartikel in Fachzeitschriften anerkannt. Noch vor dem Ende seiner Promotion 2015 konnte Daniel Streitz als Visiting-PhD-Student bei der Europäischen Zentralbank Einblicke gewinnen, von denen er bis heute profitiert. Nach einem Intermezzo als Postdoc an der Universität Bonn wechselte Daniel Streitz in eine Beratungsfirma, die u. a. bei Kartell- und Fusionskontrollverfahren tätig ist. Die Wissenschaft habe ihn aber weiter gereizt und so ging er 2017 als Assistant Professor an die Copenhagen Business School. Von dort kam der Ruf nach Jena. Gleichzeitig arbeitet Prof. Streitz am Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Für ihn eine ideale Kombination, wie er sagt. Einmal kann er so von seinem Wohnort Leipzig aus beide Arbeitsorte gut erreichen, zum anderen kann er die Kooperation mit weiteren Universitäten im mitteldeutschen Raum intensivieren.
Aktuell untersucht Daniel Streitz die Zusammenhänge von Entscheidungen an den Finanzmärkten und CO2-Emmissionen von Unternehmen. Daniel Streitz ist ledig, sportbegeistert – u. a. ist er mehrfach den Berliner Halbmarathon mitgelaufen – und hat sich in Berlin an einem Urban-Gardening-Projekt beteiligt. In seiner übrigen Freizeit liest er gern, am liebsten Gegenwartsliteratur von zumeist angelsächsischen Autoren.
Laudien
-
Hendrik Süß
Hendrik Süß
Foto: Jürgen Scheere (Universität Jena)Reine Mathematik hat eine philosophische Komponente – dieser Meinung ist Prof. Dr. Hendrik Süß. Denn im Gegensatz zur angewandten Mathematik werden hier ganz grundlegende Fragen beantwortet, deren Ursprung meist schlicht und einfach Neugier ist. Genau diese Neugier ist es auch, die den neuen Professor für Algebra der Friedrich-Schiller-Universität Jena antreibt.
Die Begeisterung für die Mathematik wurde bei Hendrik Süß schon früh geweckt: „Ich hatte das Glück, dass meine Lehrer in der Grundschule erkannten, dass ich für Mathematik eine Begabung habe, und mich besonders förderten.“ Eine Lehrerin war es auch, die ihn darin bestärkte, seine schulische Laufbahn an einem Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt fortzusetzen. Hier nahm er in der Oberstufe am sogenannten Schülerstudium teil, einem Förderprogramm der Berliner Universitäten, das Schülerinnen und Schülern einen ersten Einblick ins Mathematikstudium ermöglichte. Ein echter Glücksfall für Süß, dem schnell klar war, dass er hier genau richtig war – obwohl sich die universitäre Mathematik in ihrer Herangehensweise stark von dem unterschied, was er aus dem Schulunterricht kannte. „Die Grundlage der Mathematik ist eigentlich Abstraktion – konkrete Dinge werden auf ein abstraktes Level gehoben“, erklärt er. „Man sieht sich Gemeinsamkeiten an, die einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auffallen, und versucht, viele verschiedene Konzepte gedanklich als ein gemeinsames Konzept zu erfassen. Und das hat mich ungemein fasziniert, was da möglich ist.“
Genau diese Faszination für die Abstraktion als Grundlage der Mathematik ist es auch, die Hendrik Süß als Dozent seinen Studierenden vermitteln möchte. „Man könnte sagen, die Mathematik ist die Wissenschaft der Abstraktion.“ Das fiele den meisten Menschen eher schwer, weil man sich dabei von dem entfernt, was man aus dem Alltag kennt. Stattdessen müsse man einen Schritt zurücktreten und versuchen, das große Ganze zu sehen. „Das ist es, was Abstraktion ausmacht.“ Unwesentliches weglassen, sich auf das Wesentliche konzentrieren, um Probleme zu lösen – so beschreibt Süß den Prozess. Dadurch ließe sich auch eine Klasse von Problemen auf einen Schlag lösen, ohne dass man jedes Mal von vorne beginnen muss. Dennoch ist dem Mathematiker bewusst, dass es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, als würde man sich die Arbeit damit schwieriger machen. „Ich will den Studierenden klarmachen, dass wir das nicht nur tun, um sie zu quälen oder um die Dinge künstlich kompliziert zu machen, sondern dass es einen Grund dafür gibt und es die Sache am Ende einfacher macht.“
Die Sache – das ist im Fall von Hendrik Süß die algebraische Geometrie. Bereits seit seiner Diplomarbeit widmet er sich diesem Teilgebiet der Mathematik, das sich mit dem Lösen von polynomiellen Gleichungen befasst, beispielsweise x2 + y2 = 1. Trägt man die Zahlenpaare, die diese Gleichung erfüllen, ins ebene Koordinatensystem ein, bilden die Punkte einen Kreis mit dem Radius 1. Es geht also um Gleichungen, deren Lösungen sich als geometrische Objekte betrachten lassen. In seiner Arbeit beschäftigt Süß sich allerdings mit weitaus komplexeren Gleichungen. Ziel ist es, qualitative Aussagen über die Lösungsmenge dieser Gleichungen oder auch einer ganzen Klasse solcher Probleme zu machen und so ihre Eigenschaften, z. B. die Dimension, zu beschreiben. „Die Fragestellung ist also eine algebraische, aber die Methoden, die wir benutzen, sind geometrisch“, fasst der Mathematiker die Grundidee seines Forschungsgebietes zusammen.
Den Großteil seiner wissenschaftlichen Karriere seit seiner Promotion 2010 an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg verbrachte Süß im Ausland – zunächst als Stipendiat der Humboldt-Stiftung in Moskau, bevor es ihn nach Großbritannien zog. Nach anderthalb Jahren als Postdoc in Edinburgh und sechs Jahren als Dozent in Manchester kehrte er nun zurück nach Deutschland. „Meine Familie und ich haben uns in England sehr wohlgefühlt, aber wir haben uns trotzdem gefreut, als ich den Ruf nach Jena bekam“, erinnert sich der 43-Jährige. Der Freistaat ist ihm alles andere als fremd – seine Mutter kommt von hier, Teile seiner Kindheit verbrachte er bei seinen Großeltern in Arnstadt. „Ich hatte also immer einen guten Draht nach Thüringen und die Idee, hierher umzuziehen, war mir gleich sympathisch.“
In Jena fühlt sich der gebürtige Berliner sehr wohl. Besonders die Nähe zur Natur genießt der passionierte Skilangläufer nach seiner Zeit in Manchester. Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der Corona-Pandemie gab es bisher noch keine Möglichkeit, einmal in großer Runde mit den Kolleginnen und Kollegen des Instituts für Mathematik zusammenzukommen und sich besser kennenzulernen. Das soll in diesem Sommersemester nachgeholt werden.
Laura Weißert
-
Dario Riccardo Valenzano
Dario R. Valenzano
Foto: Anne Günther (Universität Jena)In einer gemeinsamen Berufung von Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) und Friedrich-Schiller-Universität Jena hat Prof. Dr. Dario R. Valenzano an der Medizinischen Fakultät eine Professur und am FLI die Leitung der Forschungsgruppe „Evolutionsbiologie/Mikrobiom-Wirt-Interaktionen beim Altern“ übernommen. Mit dem neuen Forschungsschwerpunkt „Mikrobiota und Altern“ am FLI steht die sich verändernde Zusammensetzung des Mikrobioms eines alternden Organismus und sein Einfluss auf die Entstehung von alternsbedingten Erkrankungen im Fokus, womit die Alternsforschung in Jena erweitert und zusätzlich gestärkt wird.
Im März 2018 hat die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) den Aufbau eines neuen Forschungsschwerpunktes „Mikrobiota und Altern“ am Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) in Jena bewilligt. Die bewilligte Finanzierung von zwei Juniorforschungsgruppen wird vom FLI durch die zusätzliche Bereitstellung einer Seniorforschungsgruppe unterstützt, als gemeinsame Professur mit der Universität. In einer gemeinsamen Berufung des FLI mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Medizinische Fakultät) hat im Juli 2021 Dario R. Valenzano vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln die Professur in Jena übernommen. Diese Professur ist zugleich mit der Leitung der Seniorforschungsgruppe „Evolutionsbiologie/Mikrobiom-Wirt-Interaktionen beim Altern“ am FLI verbunden.
Mit dem neuen Forschungsschwerpunkt steht die sich verändernde Zusammensetzung des Mikrobioms eines alternden Organismus im Mittelpunkt des Interesses. Ziel ist es, den Beitrag der Mikrobiota eines Organismus (d. h. des Mikrobioms) bei der Entstehung und Vorbeugung von alternsbedingten Krankheiten und Funktionsstörungen zu klären. Dieser neue Fokus auf die Rolle des Mikrobioms beim Altern ist eine wichtige Ergänzung zu den bereits bestehenden Jenaer Forschungsprojekten.
„Ich freue mich sehr, meine Forschungsgruppe am FLI aufbauen zu können“, berichtet Prof. Dario R. Valenzano. „Wir werden hier in der Lage sein, den Einfluss der Wechselwirkung zwischen Wirt und Mikrobiom – der Gesamtheit aller mit ihm verbundenen Mikroorganismen – auf den Alternsprozess zu untersuchen. Daher freue ich mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit den Studierenden, aber auch mit meinen neuen Kollegen und anderen Partnern an der Universität.
Um die Dynamik der Wirt-Mikrobiom-Interaktionen zu untersuchen, verbindet die Valenzano-Gruppe die Ökologie dieser Interaktionen mit der evolutionären Genomik. „Uns interessiert vor allem, wie sich die mikrobielle Dynamik während des Lebenszyklus des Wirts entfaltet und wie sich neue mikrobielle Stämme in der Zeitskala des Wirtslebens entwickeln. Außerdem untersuchen wir, ob der Wirt selbst eine aktive Rolle beim Aufbau und dem Erhalt eines gesunden Mikrobioms spielt und wie das Altern des Wirts zu einem Ungleichgewicht zwischen Wirt und Mikroben führt."
„Die breitgefächerte wissenschaftliche Expertise von Prof. Valenzano verspricht, über die alternsbezogene Mikrobiomik hinaus auch die Forschung auf den Gebieten der Immunbiologie und der Genomevolution zusammen mit unseren Kooperationspartnern des Forschungsstandortes Jena nachhaltig zu stimulieren“, sagt der Wissenschaftliche Direktor des FLI, Prof. Alfred Nordheim.
Zur Person:
Dario Riccardo Valenzano, 1977 geboren in Bari, Italien, studierte Neurowissenschaften an der Scuola Normale Superiore in Pisa, Italien. Von 2006 bis 2013 war Dr. Valenzano in der Forschungsgruppe von Dr. Anne Brunet (Department of Genetics) an der Stanford University in Stanford, USA, tätig; erst als Postdoctoral Research Fellow und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Ab 2013 leitete Dr. Valenzano am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln die Forschungsgruppe „Evolutionäre und experimentelle Biologie des Alterns“ und ist seit 2016 im Exzellenzcluster CECAD der Universität zu Köln Principal Investigator.
Seit Juli 2021 ist er Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Medizinische Fakultät) und Leiter der Forschungsgruppe „Evolutionsbiologie/Mikrobiom-Wirt-Interaktionen beim Altern“ am Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) in Jena.
Sein Forschungsteam untersucht bei verschiedenen Tierarten die genomischen Grundlagen für kurze und lange Lebensspannen und erforscht die Rolle von Darmmikroben während des Alternsprozesses. Sein wichtigstes Modellsystem ist der von Natur aus kurzlebige Türkise Prachtgrundkärpfling (Killifisch, Nothobranchius furzeri), den er sowohl im Labor als auch in seinem natürlichen Lebensraum in der afrikanischen Savanne untersucht.
(Kerstin Wagner )
-
Christoph Vatter
Christoph Vatter
Foto: Jürgen Scheere (Universität Jena)Was macht Deutschland, was macht Europa aus? „Man versteht sich erst, wenn man von außen auf sich schaut“, sagt Prof. Dr. Christoph Vatter, neuer Professor für Interkulturelle Wirtschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Kulturtheorie und Kommunikationsforschung der Universität Jena. Daher nimmt Vatter gerne die Außenperspektive ein, um die Länder und Menschen Europas besser zu verstehen. Er will „international arbeiten und forschen“. Der frankophile Wissenschaftler arbeitet beispielsweise gerne in und über Kanada sowie Afrika. „Europa ist ohne Afrika nicht zu denken“, ist er überzeugt und hat sich daher vorgenommen, „Europa afropäisch zu denken“. Seine Forschung, so hofft er, soll auch dazu beitragen, „Eurozentrismus zu überwinden“.
Prof. Vatter erforscht die interkulturelle Kommunikation aus kulturwissenschaftlicher Sicht, z. B. durch komparatistische Medienanalysen. Denn für ihn „wird das Erkenntnispotenzial von Populärkultur für den Wandel gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse weithin unterschätzt“. Dem wirkt der 47-jährige Neu-Jenaer u. a. durch seine Mitarbeit in der Forschungsgruppe „Populärkultur transnational – Europa in den langen 1960er Jahren“Externer Link entgegen. Bei diesem Projekt scheut er sich auch nicht, eine Doktorandin Fernsehen gucken zu lassen, um dabei fremde Kulturen in TV-Unterhaltungsshows verschiedener Länder zu analysieren. Das helfe, die alltägliche Verflechtung und die Kommunikationsbeziehungen zwischen den untersuchten Ländern besser zu verstehen.
Ein grenzüberschreitendes Band ist Christoph Vatters besonderes „Steckenpferd“: die deutsch-französischen Beziehungen. Vatter, der viele Jahre an der Universität des Saarlandes gearbeitet hat, kennt die alltäglichen und die besonderen Beziehungen der beiden Länder und ihrer Menschen. Er hat die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder analysiert, hat grenzüberschreitend EU-Bildung, Jugend- und Praktikantenaustausch erforscht und unterstützt – und ist dabei zum Frankreich-Kenner geworden.
Der Wechsel aus dem Saarland nach Thüringen ist ihm daher nicht ganz leichtgefallen. „Aber Jena ist für die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation sehr bekannt“, sagt Prof. Vatter und verweist auf die relative Breite des Fachs und die sehr aktiven Studiengänge. Die Friedrich-Schiller-Universität biete ihm die Chance, „weiterhin stark interdisziplinär zu arbeiten“. Und so fiel dem verheirateten Wissenschaftler der Umzug nach Jena nicht schwer. Mit Hund, Katze und Jongliermaterial – „Jonglieren macht den Kopf frei“ – hat er sich an der Saale inzwischen eingelebt. Geholfen hat ihm dabei auch der Kontakt mit „den sehr engagierten Studierenden hier in Jena“, die er gerne unterrichtet, „weil es Spaß macht, gemeinsam zu lernen“ – und Christoph Vatter meint damit ein Lernen in beide Richtungen.
Christoph Vatter wurde 1974 in Neustadt/Weinstraße geboren. Nach dem Abitur studierte er Interkulturelle Kommunikation, Französische Sprach- und Literaturwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache an den Universitäten in Saarbrücken und Laval (Kanada). Er wurde 2008 an der Universität des Saarlandes und der Université Paul Verlaine-Metz mit einer Arbeit zum „Gedächtnismedium Film. Holocaust und Kollaboration in deutschen und französischen Spielfilmen seit 1945“ promoviert. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Juniorprofessor für Interkulturelle Kommunikation an der Saarbrücker Uni und vertrat Professuren in München und Halle-Wittenberg, bevor er dem Ruf an die Universität Jena folgte. Gastdozenturen führten ihn u. a. nach Georgien, in die Ukraine und nach Gabun. Seit langem unterstützt er Unternehmen und außeruniversitäre Bildungseinrichtungen mit interkulturellen Trainings und durch Beratung.
Axel Burchardt
-
Melanie Weirich
Melanie Weirich
Foto: Anne Günther (Universität Jena)Sprechen Frauen tatsächlich schneller als Männer? Ändert sich unsere Sprechweise in Abhängigkeit von der Sprechsituation, vom jeweiligen Gegenüber? Welche Register ziehen wir beim Sprechen mit einem Kollegen? Welche mit einer Vorgesetzten? Es sind Fragen wie diese, die Prof. Dr. Melanie Weirich faszinieren. Die 42-jährige Wissenschaftlerin hat eine Heisenberg-Professur für Sprechwissenschaft und Phonetik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne, die fünf Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird.
„Unsere Stimmlage variiert je nach Situation und das nehmen die Hörer auch wahr“, sagt Melanie Weirich. So sei es ein großer Unterschied, ob wir gutgelaunt mit unserem Gegenüber flirten oder innerlich angespannt ein Bewerbungsgespräch führen. Als Phonetikerin möchte Prof. Weirich herausfinden, welche sprachlichen Variationen es gibt und welche Gründe diese Variationen haben. Grundlegend, so Weirich, gebe es biologische und soziale Gründe, die sich auf unsere Sprechweise auswirken. So sei beispielsweise das Längenverhältnis von Rachenraum und Mundraum bei Frauen anders als bei Männern. Spannender seien jedoch allemal die kulturellen Unterschiede, die den Forschenden viel über Rollenbilder und Klischees verraten. „Spricht ein Mann mit tiefer Stimme, wird er als attraktiv und kompetent wahrgenommen“, sagt Prof. Weirich. Frauen hingegen gewinnen mit einer hohen Stimme an Attraktivität, steigern aber vermeintlich ihre Kompetenz, wenn sie mit einer tieferen Stimme sprechen. In Schweden, wo die Geschlechterrollen deutlich stärker aufgeweicht sind als in Deutschland, zeigen auch stimmliche und sprecherische Parameter eine Annäherung der Geschlechter, wie eine aktuelle Studie zeigt.
Wichtig ist Weirich, neben biologischen auch soziale bzw. identitätsbasierte Gründe für sprecherspezifische Variabilität in den Fokus zu rücken und Sprache im Licht verschiedenster Bereiche wie Gesellschaft, Kultur und Psychologie zu verstehen, zu lehren und zu erforschen. Ihre Forschung innerhalb der Heisenbergprofessur beschäftigt sich daher mit dem Zusammenspiel von sozialen und biologischen Faktoren hinsichtlich geschlechtsspezifischer phonetischer Parameter: Zum einen beleuchtet sie den Einfluss von Hormonen (wie Testosteron und Östrogen), zum anderen Umweltfaktoren wie das berufliche Umfeld (z. B. Handwerkerinnen vs. Erzieherinnen). Für ihre Forschungen möchte Melanie Weirich mehr auf die Straße gehen, im Wortsinn. Gern würde sie mit ihrem Team untersuchen, welche Sprechmuster in Berufsfeldern zu finden sind, die von einer Geschlechtergruppe dominiert werden. „Es gibt nur ein Problem: Wir haben schlicht nicht genügend Handwerkerinnen gefunden“, sagt Melanie Weirich. Aktuell sieht es aber danach aus, für die Studie Polizistinnen und Soldatinnen gewinnen zu können.
In einer Studie am Leibniz-Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) in Berlin haben Melanie Weirich und ihre Kollegin Dr. Stefanie Jannedy das sogenannte Kiezdeutsch untersucht. Dieser Soziolekt wird vornehmlich in multi-lingualen und multi-ethnischen Vierteln Berlins (z. B. Kreuzberg) gesprochen. „Kiezdeutsch gilt als cool, weshalb es auch andere Jugendliche sprechen“, sagt Prof. Weirich. Außenstehende Hörerinnen und Hörer lassen hingegen bei der Bewertung dieser Sprachform deutlich andere Werturteile erkennen, es wird als „schlechtes Deutsch“ wahrgenommen. Interessanterweise spielt bei der Bewertung einer nicht-standardnahen Aussprache die angenommene Herkunft der Sprecher eine Rolle: Die Aussprache eines „ch“ wie in Löcher als „sch“ wie in Löscher wird negativer bewertet, wenn die Hörer glauben, sie kommt von einem Kiezdeutschsprecher statt von einem Franzosen, der mit Akzent Deutsch spricht. Dies fand sich allerdings nur bei älteren Hörern, bei jüngeren spielte die vermeintliche Herkunft keine Rolle. Das Prestige einer Varietät ist somit stark mit dem Ansehen der Sprechergruppen verbunden und unterscheidet sich zwischen Hörern je nach deren Assoziationen, Erwartungen und auch Stereotypen.
Melanie Weirich stammt aus Trier. In ihrer Heimatstadt hat sie Phonetik, Psychologie und Germanistische Literaturwissenschaft studiert. Ein weiterer Studienort war die „Mittuniversitetet“ im schwedischen Östersund. 2007 arbeitete sie als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an der TU Dresden und der Volkshochschule. Für ihre Promotion 2008 bis 2011 erforschte sie an der Humboldt-Universität Berlin den Einfluss biologischer und sozialer Faktoren auf sprecherspezifische Unterschiede bei ein- und zweieiigen Zwillingspaaren. Im Anschluss daran arbeitete Melanie Weirich in einem DFG-Projekt zu akustischen und artikulatorischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern und leitete danach ihr eigenes Projekt zum Einfluss der Elternrolle auf das Sprechen an der Universität Jena. Zuletzt war sie im Projekt „Variation in Situated Interaction“ am ZAS tätig.
Stephan Laudien
-
Sebastian Weis
Prof. Weis
Foto: UKJAls neuer Professor für Translationale Infektionsforschung am Universitätsklinikum Jena untersucht Sebastian Weis in Labor und Klinik, wie der Körper als Schutzreaktion auf schweren Infektionen den Stoffwechsel in Geweben anpasst und ob sich solche Mechanismen für neue Behandlungen nutzen lässt.
Sebastian Weis, Oberarzt am Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena (UKJ), erforscht die Veränderungen des Stoffwechsels bei schweren systemischen Infektionen und hat zum Wintersemester 2021 die neu eingerichtete Professur für Translationale Infektionsforschung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena angetreten.
Wissenschaftlich beschäftigt er sich insbesondere mit Abwehrstrategien des Körpers, die sich nicht gegen die Erreger oder von ihnen produzierte Gifte richten. Prof. Weis: „Diese Anpassungsprozesse ermöglichen es dem infizierten Körper, Schäden am Gewebe in einem gewissen Maß hinzunehmen, wir bezeichnen das als Krankheitstoleranz oder Resilienz. Wir untersuchen, wie diese Adaptionen reguliert sind, ob sie Schutzwirkung haben oder zusätzlichen Schaden anrichten und, das ist das eigentliche wichtigste, ob sie sich als Therapieansatz eignen. Der Schutz und die Unterstützung der Organfunktion sind ein zentrales Therapieziel bei schweren Infektionen.“
Prof. Weis begann bereits früh während seines Medizinstudiums in Leipzig mit der Grundlagenforschung. Er unterbrach das Studium für einen einjährigen Forschungsaufenthalt in den USA, um an der Stanford University in Kalifornien für seine Doktorarbeit zu forschen. Nach der Facharztweiterbildung zum Internisten am Universitätsklinikum Leipzig ging er mit einem DFG-Stipendium an das Instituto Gulbenkian de Ciência in Oeiras, Portugal, und untersuchte Abwehrmechanismen des Körpers bei schweren Infektionen. Danach wechselte er Ende 2014 an das UKJ. „In Jena waren und sind die Bedingungen für die Vereinbarkeit für die Kombination aus klinischer Infektiologie und infektiologischer Grundlagenforschung einzigartig“, so Prof. Weis. Hier habilitierte er sich mit seinen Forschungsergebnissen zur Stoffwechselanpassung in der Sepsis und erwarb die Zusatzbezeichnung Infektiologie. Für die Professur in Jena lehnte er Rufe an die Exzellenzuniversitäten Hamburg, Tübingen und Dresden ab.
Prof. Weis ist lokal im Jenaer Infektionsforschungsnetzwerk und darüber hinaus bestens vernetzt. Er führte die SUPPORT-Studie im Zentrum für Sepsis- und Sepsisfolgen CSCC durch, war dort Vorstandsmitglied, ist maßgeblich an der Neustadt-Studie und im von der EU-geförderten Forschungsverbund Immunosep zur personalisierten Immuntherapie bei Sepsis beteiligt. Außerdem warb er beim Bundesforschungsministerium Mittel für eine Phase-I-Sepsis-Therapiestudie ein und forscht im Jenaer Exzellenz-Cluster. Die Arbeitsgruppe wird an das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie - Hans-Knöll-Institut assoziiert. „Diese Verbindung ist eine hervorragende Möglichkeit für neue Kooperationen und einem Ausbau der Zusammenarbeit zwischen dem UKJ und dem HKI“, so Prof. Weis.
UvdG
-
Roland Winkler
Roland Winkler
Foto: Jürgen Scheere (Universität Jena)Beleben kurzfristige Steuersenkungen, wie sie beispielsweise während der Coronapandemie erfolgten, die Wirtschaft? Wie sehr stützen im Vergleich dazu staatliche Ausgabenprogramme, also Investitionen in Straßen und Windräder und Ausgaben für Bibliotheken und Schulen, die Konjunktur? Wer profitiert besonders von solchen Maßnahmen? Die Frage nach den Konsequenzen fiskalpolitischer Handlungen gehört zu den ewig jungen Themen der Wirtschaftswissenschaft, hat aber in letzter Zeit bedeutende methodische Fortschritte erlebt, erläutert Prof. Dr. Roland Winkler von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Der neuberufene Professor für Volkswirtschaftslehre (VWL) mit dem Schwerpunkt Makroökonomie gehört zu denen, die die Wirksamkeit und den Erfolg von fiskalpolitischen Maßnahmen sehr engagiert analysieren und wirtschaftspolitische Fragen erforschen.
Die aktuelle Coronapandemie bietet für den Volkswirt – bei aller Brisanz für den Einzelnen –viel Anschauungsmaterial. Grundsätzlich, sagt der gebürtige Bremer, sei die Belebung der Wirtschaft durch Fiskalpolitik vor allem „in Krisenzeiten sinnvoll“. Die Art und der Erfolg hingen aber vom Zustand der jeweiligen Ökonomie ab, daher seien allgemeingültige Aussagen zum Erfolg schwierig. „Es kommt darauf an“, ist ein Satz, den er häufig einsetzen muss, weil Forschungsergebnisse nicht problemlos von einem Land aufs andere übertragbar sind. Oder weil die Ergebnisse nicht von einem Wirtschaftszweig oder Förderprogramm auf andere angewendet werden können.
So sei die kurzfristige Mehrwertsteuersenkung in Deutschland während der Coronapandemie „ein klares Instrument zur Stimulierung der Konjunktur gewesen“, sagt der Neu-Jenaer. Die aktuelle Studienlage spricht für eine deutliche Stimulierung der Nachfrage durch diese Maßnahme.
Winkler selbst hat in seinen aktuellen Forschungen stärker die USA im Blick. Gemeinsam mit Kollegen hat er untersucht, wie dort ein Konjunkturpaket gestaltet sein sollte, um die Entstehung von Arbeitsplätzen für diejenigen anzuregen, die im Zuge der Coronakrise ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das Resultat in Kürze: Breitangelegte Erhöhungen der Staatsaufgaben helfen vor allem dienstleistungsnahen Beschäftigten, Arbeiter profitierten hingegen kaum davon. Für diese Arbeitnehmer sei eine Steuersenkung auf Arbeit, etwa über die Einkommenssteuer, sinnvoll, schlägt er einen Weg vor, den er aus seinen Simulationsstudien ableiten konnte. „Wir können nur begrenzt Experimente durchführen und ins Labor gehen“, sagt Prof. Winkler. Stattdessen arbeitet der Makroökonom quantitativ mit Daten und Statistiken und simuliert in Modellen verschiedene Szenarien konjunktureller Entwicklungen und staatlicher Reaktionen. „Das Fach ist sehr viel empirischer geworden“, betont er. Und das will der Wirtschaftswissenschaftler auch seinen Studierenden in Jena vermitteln. Am Beispiel relevanter Fragestellungen sollen Daten und theoretische Analysen verbunden werden. „Wenn mir das gelingt und die Studierenden dabei die verschiedenen Ansätze und Annahmen kritisch hinterfragen, dann bin ich mit meiner Lehre zufrieden“, bringt er sein Vermittlungsprinzip auf den Punkt.
Seine Lehre sei aus einem Learning by doing entsprungen, habe aber durch seine fünf Jahre an der Universität Antwerpen, wo ein Lehrzertifikat verpflichtend ist, deutlich gewonnen. Der Austausch zur Lehre über das eigene Fach hinaus habe ihm Perspektiven eröffnet, die er nun auch in Jena anwenden wird. Einer Stadt in einem für ihn neuen Bundesland, die er schon nach wenigen Wochen für ihre Natur und die Kultur schätzen gelernt hat – trotz der Pandemiebeschränkungen.
Roland Winkler wurde 1977 in Bremen geboren. Er studierte VWL in Kiel, wo er 2009 mit einer Arbeit über Konjunkturzyklen promoviert wurde. Als Postdoc arbeitete Winkler am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und an der Goethe-Universität in Frankfurt/M. 2011 wechselte er als Juniorprofessor an die TU Dortmund und 2017 auf eine Professur für Makroökonomie an die Universität Antwerpen. Diese verließ er in diesem Jahr und nahm den Ruf an die Friedrich-Schiller-Universität Jena an.
AB
-
Christina Zielinski
Christina Zielinski
Foto: Anna Schroll/Leibniz-HKIProfessorin Christina Zielinski leitet seit Beginn dieses Jahres die neue Abteilung „Infektionsimmunologie“ am Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut – (Leibniz-HKI) und folgt dem Ruf auf die gleichnamige Professur an der Friedrich-Schiller-Universität. Als engagierte Forscherin sucht sie immer nach der besten aller möglichen Optionen. Sie verfolgt damit eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere und engagiert sich für ihre Kolleginnen.
„Ich wollte eigentlich schon immer Medizin studieren und Menschen mit Krebs helfen“, so Zielinski. Und auch wenn die allererste Vorlesung im Bereich Immunologie die fürchterlichste in ihrem Studentenleben war, wurde ihr während der Doktorarbeit bewusst: „Das Immunsystem ist eigentlich das System mit der meisten Power, Krankheiten zu heilen aber auch Krankheiten zu verursachen.“ Die gebürtige Rheinland-Pfälzerin entdeckte damit ihre Faszination für grundlegende Fragen des Immunsystems, die sowohl für die Bekämpfung von Infektionen, aber auch für Krebs und Autoimmunerkrankungen enorm wichtig sind. Während der Facharztausbildung zur Dermatologin erkannte die Medizinerin erneut die Bedeutung des Immunsystems und wandte sich zunehmend der Forschung zu. „Die Arbeit mit den Patienten fand ich unglaublich zufriedenstellend.“ Doch der Drang, neue Erkenntnisse zu generieren und damit Grundlagen für neue Therapien zu ermöglichen, war größer.
In ihrer Forschung konzentriert sich Zielinski auf die sogenannten T-Zellen. Sie spielen eine entscheidende Rolle im menschlichen Immunsystem. So fand sie mit ihrem Team als erste heraus, dass Th17-Zellen auf die Erkennung des krankheitserregenden Pilzes Candida albicans spezialisiert sind. „Wir wissen deshalb jetzt, dass Patient*innen an diesen Infektionen leiden, weil sie zu wenige oder nicht richtig funktionierende Th17-Zellen haben. Wir wissen auch, wie man sie vermehren oder ihre Funktion verbessern kann, um damit die Candida-Infektion in Schach zu halten“, hält die Forscherin fest. Zielinski denkt pragmatisch und das nicht nur bei der Auswahl der nächsten beruflichen Station: Ihr ist es wichtig, stets ein konkretes klinisches Problem zu lösen. „Wenn man dann ein Ergebnis hat, auch wenn es immer nur ein kleiner Baustein ist, dann ist es sehr schön, den Patienten zu helfen.“
Zielinskis Team aus Wissenschaftler*innen der Medizin, Biologie, Biochemie und Bioinformatik wird künftig weiter an Pilzinfektionen des Menschen forschen. Erkenntnisse darüber, wie das menschliche Immunsystem – insbesondere die T-Zellen – bestimmte Pilze erkennt und sie zielgerichtet bekämpft, sollen Patient*innen mit Pilzinfektionen künftig in Form von Therapien zugutekommen. Darüber hinaus beschäftigt sich ihre Gruppe als Vorreiter mit sogenannten residierenden, also im Gewebe verharrenden Immunzellen. Bisher konzentrierten sich Immunolog*innen hauptsächlich auf das zirkulierende Immunsystem, genauer auf die Immunzellen des Blutes. Zielinski möchte herausfinden, was T-Zellen dazu führt, ins Gewebe zu wandern und dort zu bleiben. Auch die Kommunikation dieser residenten Zellen untereinander oder deren Interaktion mit dem Mikromilieu des umgebenden Gewebes möchte sie untersuchen. Residente T-Zellen können nicht nur vor Infektionen schützen, sondern bei einer Fehlregulation auch Autoimmunerkrankungen auslösen.
Besonders wichtig ist der Wissenschaftlerin ein stetiger und kreativer Austausch nicht nur mit Kolleg*innen weltweit, sondern auch mit Ihrem eigenen Team. Sie diskutiert im Labor über Forschungsprojekte, sieht Daten und gibt Feedback. Und dann gerät die Forscherin ins Schwärmen: „Nach langen Arbeitstagen im Büro mit vielen Verwaltungsaufgaben packt es mich manchmal. Ich liebe es dann total, wenn ich eine Pipette in der einen Hand habe und ein Tube [ein kleines Reagenzgefäß] in der anderen. Da bin ich völlig euphorisch.“ Zielinski fängt an zu lachen. „Während der Inkubationszeit des Experiments gehe ich dann ins Büro zurück und vergesse manchmal, das Experiment weiterzumachen. Das fällt mir dann eine Woche später im Schlaf ein. Meine Leute lachen immer schon, wenn sie mein nicht weiter verarbeitetes Tube im Labor finden.“
Neben ihrer Forschung engagiert sich Zielinski auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ihr liegt besonders die Förderung von Frauen in der Wissenschaft am Herzen: „Ich finde es nicht so einfach als Frau in der Forschung und bin deshalb sehr gerne Mentorin insbesondere für Wissenschaftlerinnen“, teilt sie beherzt mit. „Ich gebe meine Erfahrungen mit Freude weiter und setze mich leidenschaftlich dafür ein, dass Leute, die es verdienen, keine Widerstände für die Erreichung ihrer Ziele erleben müssen.“ Zielinski hofft, dass Führungspositionen künftig diverser besetzt sind und legt ihren Kolleg*innen nahe, ein gutes Netzwerk zu pflegen.
Als es um arbeitende Mütter im Lockdown geht, sagt die Medizinerin entschlossen: „Das funktioniert nur, wenn man eine gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe hat. Immer, wenn es schwierig ist, sind gegenseitiger Respekt und das Verständnis füreinander wichtig, um sich zu unterstützen.“ Reflektiert hält sie außerdem fest, sehr privilegiert zu sein, da sie in der Wissenschaft flexibel und unabhängig arbeiten könne. Die Arbeits- und Betreuungszeit ihres Kindes teilt sie sich mit ihrem Mann, der ebenfalls eine Professur innehat. Gemeinsam mit Kolleg*innen vom Universitätsklinikum Jena beschäftigt sich Zielinski auch mit der Reaktion von Immunzellen auf eine Corona-Infektion und leistet ihren eigenen Beitrag zur Überwindung der gegenwärtigen Krise.
Unabhängig von den aktuellen Maßnahmen in der Corona-Pandemie wünscht sich Zielinski von der Politik, dass sie ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stelle, sodass alle arbeiten und sich einbringen können.Nach Stationen unter anderem an der Yale University in den USA, der Charité-Universitätsmedizin Berlin und zuletzt an der TU München bekleidet die Medizinerin seit Januar die Professur für Infektionsimmunologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und leitet die gleichnamige neue Abteilung am Leibniz-HKI. Die Immunologin freut sich auf „die tollen Möglichkeiten mit einer fantastischen Infrastruktur.“
(Kirsch)
-
Alexander Zipprich
Alexander Zipprich
Foto: Michael Szabó/UKJ„Die medikamentöse Therapie der Hepatitis C hat sich in den letzten Jahren durch neue Wirkstoffe dramatisch geändert, mit Heilungsraten weit über 90% und wesentlich besserer Verträglichkeit“, beschreibt Prof. Dr. Alexander Zipprich einen bedeutenden Fortschritt in seinem Fachgebiet. Der 49-jährige Internist und Gastroenterologe ist Spezialist für Lebererkrankungen, seit März hat er die neu eingerichtete Professur für Hepatologie am Universitätsklinikum Jena inne, die an der Klinik für Innere Medizin IV angesiedelt und mit der stellvertretenden Leitung dieser Klinik verbunden ist.
Die Leber ist die Stoffwechselzentrale unseres Körpers: Sie verarbeitet fast alles, was wir zu uns nehmen. Sie entgiftet, sie produziert Eiweißstoffe und reguliert so wichtige Prozesse wie z.B. die Blutgerinnung. Ihr können Infektionen zusetzen, wie die durch Viren verursachte Hepatitis C. Häufiger aber sind Gifte, allen voran Alkohol, oder ein Zuviel von Fett und Zucker die Ursache für Schädigungen an dem Organ. Die Leber ist sehr widerstandsfähig und kann moderate Schäden lange ausgleichen, wegen ihrer Schmerzunempfindlichkeit sendet sie auch keine Warnsignale. „Langfristig kommt es jedoch zu Entzündungserscheinungen und Umbauprozessen, in deren Folge das normale Gewebe der Leber umgebaut wird. Bei der Leberzirrhose büßt das Gewebe seine Funktion ein und es kommt zur Bauchwassersucht und Entstehung von Krampfadern in der Speiseröhre, auch das Risiko für Leberkrebs erhöht sich“, so Prof. Zipprich.
Nur durch rechtzeitige Diagnosestellung und Therapie lässt sich verhindern, dass eine weitere Verschlechterung eintritt und eine Transplantation notwendig wird, „einen Organersatz für die Leber, wie die Dialyse für die Nieren, gibt es leider nicht.“ Für die Fettleber, eine durch Übergewicht bedingte Vorstufe der Leberzirrhose, sind vielversprechende Wirkstoffe in der Entwicklung. Alexander Zipprich: „An den klinischen Studien für diese Wirkstoffe werden wir uns beteiligen, um unseren Patienten solche neuen Behandlungsmöglichkeiten zu eröffnen.“ Ziel ist es, den fortschreitenden Verlust der Organfunktion zu bremsen oder aufzuhalten. Ist das nicht mehr möglich, kann zumindest die Notwendigkeit einer Transplantation hinausgezögert werden. Zum Beispiel lässt sich durch einen TIPS genannten Kurzschluss zwischen den Lebergefäßen die akute Gefahr der Krampfaderblutung und der Bauchwassersucht vermindern. „Zusammen mit den Kollegen der Chirurgie und Radiologie wollen wir die Betreuung der Patienten eng verzahnen und auch im ambulanten Bereich gemeinsame Sprechstunden etablieren“, so Alexander Zipprich.
Der gebürtige Hallenser hat in seiner Heimatstadt Medizin studiert und beschäftigte sich schon in seiner Promotion mit der Leberdurchblutung. Seine Facharztausbildung in der Inneren Medizin und Gastroenterologie am Universitätsklinikum Halle unterbrach er für einen zweijährigen Forschungsaufenthalt an der Yale University. In Halle habilitierte sich Alexander Zipprich zur hepatisch-arteriellen Durchblutung der zirrhotischen Leber und leitete eine eigene Arbeitsgruppe „Molekulare Hepatologie“. Zuletzt arbeitete er als leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin I am Uniklinikum Halle.
In der Grundlagenforschung untersucht Alexander Zipprich die molekularen Mechanismen des zirrhotischen Gewebeumbaus, bei dem Leberzellen durch Bindegewebszellen ersetzt werden. Zum Beispiel erforscht er mit Förderung der DFG die Beteiligung eines Steroidhormonrezeptors am Fortschreiten des Umbauprozesses. „Wir wollen den Übergang von der Fibrose zur Zirrhose besser verstehen, um daraus neue Therapie- oder Präventionsansätze entwickeln zu können“, erklärt Professor Zipprich. „Denn es gilt, durch weitere Fortschritte in der Lebermedizin die Funktion dieses faszinierenden Organs noch besser zu schützen und zu erhalten.“(vdG)