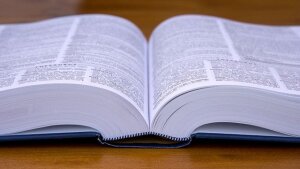Zielsetzung
Im Rahmen des Projekts „Freiheitsräume und Freiheitssicherung im digitalen Staat“ sollen die Funktionsweise des Staates unter den Bedingungen der Digitalisierung zunächst aus der Perspektive der Rechts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften sowie der Linguistik erörtert werden. Ausgehend von der westlichen Freiheitstradition, die eine der wesentlichen Errungenschaften der letzten ca. 200 Jahre darstellt, sollen Freiheitsräume im digitalen Staat unter Berücksichtigung der informationstechnischen Entwicklung positiv wie negativ bestimmt, ihre Gefährdungen identifiziert und mögliche Reaktionen auf diese erforscht werden. Dabei gilt es auch, der Funktionsfähigkeit des Staates angemessen Rechnung zu tragen, zumal diese für die Freiheitssicherung seiner Bürger eine wesentliche Voraussetzung bildet.
Rechtswissenschaftliche Perspektive
Legal
Foto: herbinisaac, pixabayAus rechtswissenschaftlicher Perspektive stellt sich diesbezüglich insbesondere die Frage, wie Grund- und Menschenrechte im digitalen Raum wirken und welche Gefährdungslagen ihnen gegenüberstehen. Gleichzeitig stehen auch private Akteure als Intermediäre im Fokus, sollte deren „digitale Macht“ und Monopolstellung in quasi-staatliche Hoheitsgewalt umschlagen. Hierauf müssen von Seiten des Staates Konsequenzen für die Rechtsordnung geprüft werden, unter anderem auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI).
Politikwissenschaftliche Perspektive
Symbolbild News
Foto: Gerd Altmann, pixabayWenn allgemein Fragen der staatlichen Regulierung und Gestaltung von Digitalisierung behandelt werden und dabei die Frage nach der Bedeutung „digitaler Macht“ aufgeworfen wird, dann lässt dies aus politikwissenschaftlicher Perspektive an die beiden großen „digitalen Mächte“ denken, die USA und die Volksrepublik China.
Die USA sind laut „Digital Economy Report 2019“ der UN trotz aller Konkurrenz aus China die führende Macht der Digitalwirtschaft, die zwar privatwirtschaftlich organisiert ist, aber zugleich von einer sehr geringen Zahl von Konzernen dominiert wird. In dieser Konstellation sind aus politikwissenschaftlicher Perspektive im Hinblick auf die USA vor allem zwei Aspekte von Interesse: Zum einen die Frage, die vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der NSA-Affäre aufkam, wie eng (und geheim) diese Konzerne der Digitalwirtschaft mit den amerikanischen Sicherheitsinstitutionen kooperieren. Und zum anderen die Frage, welche Bedeutung sich regender Widerstand gegen die Dominanz der Konzerne in den USA selbst entwickelt. Wie weit ist die Politik in den USA gewillt, zu mehr Regulierung „digitaler Macht“ zu gelangen und welche Instrumente der Regulierung werden diskutiert?
Die Volksrepublik China steht einerseits für den staatlichen Einsatz digitaler Kontrolltechniken an, die darauf zielen, möglichst alle digitalen Spuren der Bürger im Rahmen eines „Sozialkreditsystems“ zusammenzuführen. Dass mit der Corona-Krise die Möglichkeiten der Kontrolle einen neuen, zusätzlichen Schub erhalten, liegt auf der Hand und führt zu einer neuen Legitimation der autoritären Parteidiktatur, die sich scheinbar als besser gerüstet erweist, mit der Pandemie fertig zu werden. Andererseits steht China auch für ein enges Verhältnis von quasi privatwirtschaftlich organisierten Internetkonzernen zu Staat und Partei.
Beide Modelle setzen den internationalen Rahmen, den europäische und nationale Regulierungen der Digitalisierung nicht werden ignorieren können. Dass die beiden Staaten mit ihren unterschiedlichen Modellen zugleich weltpolitische Konkurrenten um Macht und Einfluss im internationalen System sind, weitet die Problemstellung auf den Bereich der politikwissenschaftlichen IB-Forschung aus.
Wirtschaftswissenschaftliche Perspektive
Symbolbild Organisation
Foto: Gerd Altmann, pixabayAus der Sicht der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik bieten sich technologische Megatrends wie die Blockchain Technologien (alias: public ledger technologies, kurz PLT) und die des machine learning (ML) als fruchtbare Forschungsfelder an.
Im Rahmen der PLT und der darauf aufgesattelten Kryptowährungen werden beispielsweise die Möglichkeiten kolportiert, internationale Überweisungen sekundenschnell und unter Umgehung aller Devisenbewirtschaftungsrichtlinien durchzuführen. Die Schaffung „grenzenloser“ Freiheit erscheint vor dem Hintergrund der Umgehung von Kontrollregimen der Zentralbanken und Regierungen weder machbar noch wünschenswert und bietet Verknüpfungen zum politikwissenschaftlichem Feld. Durch PLT ergeben sich auch neue Freiheitsräume durch sogenannte smart contracts, an denen überdies auch der Staat beteiligt sein kann und der diese darüber hinaus durch seine Rechtsordnung ausgestalten muss.
Aus dem Rahmen der relevanten ML-Verfahren sei nur das Feld der systematischen Beeinflussung des Meinungsbildungsprozesses in sozialen Medien herausgegriffen, insbesondere durch „troll factories“ und entsprechende Internet-Beiträge. Die automatisierte Identifikation derartiger Beiträge wird auch unter Heranziehung sekundärer Kriterien immer schwieriger. Zu untersuchen wäre, ob die Beiträge nicht in Isolation, sondern aus dem Vergleich vieler Beiträge – auch über soziale Medien hinweg – zu entdecken sind. Parallel wird man erörtern müssen, wie unsere Gesellschaft künftig mit dem Fakt einer anhaltenden Überschwemmung mit „fake news“ und „fake opinions“ umgeht.
Linguistische Perspektive
Symbolbild Übersetzung
Foto: Shaun F, pixabayDie linguistische Perspektive wird sich vor allem auf das Thema digitale Kommunikation konzentrieren. Digitalisierung wird gleichermaßen als Chance und Bedrohung wahrgenommen. Dem unmittelbaren Nutzen digitaler Produkte und Anwendungen, wie z.B. automatischer Übersetzungsprogramme, stehen Sorgen entgegen, dass zum einen menschliche Arbeitskraft an Wert verliert und zum anderen ein Missbrauch der vorhandenen Technologien, z.B. durch den Staat oder internationale Konzerne, stattfindet und im Ergebnis persönliche Freiheit verloren geht. Daraus ergeben sich zahlreiche Herausforderungen, die im politischen Raum – in der medialen Öffentlichkeit ebenso wie im Parlament – diskutiert werden. Mithilfe korpuslinguistischer Methoden sollen deshalb verschiedene öffentliche Diskussionsräume unter Verwendung computerlinguistischer Methoden untersucht werden wie z.B. Hate Speech in den Massenmedien und auf sozialen Medien und ihre Formen, Ziele und Dynamiken oder die Verwendung der Metapher des Krieges für die Rechtfertigung von Begrenzungen im öffentlichen Leben oder im Internet. Weitere Forschungsthemen sind die Interaktion und Kommunikation zwischen Regierungen und Bürgern auf Twitter mithilfe der Sentiment Analyse und die linguistische Analyse von Falschinformationen/fake news mit den Methoden wie semantic embedding.
Zeitplan
Die vorstehenden Fragen umreißen nur einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle sich dringlich stellender Fragen, zu deren Beantwortung die Wissenschaft einen wichtigen Beitrag leisten kann und muss. Die vorliegend beteiligten Fächer ergänzen sich dabei und sind gerade in ihrer Verbindung geeignet, neue Perspektiven auf die Themenstellung zu eröffnen. Auch erscheint perspektivisch die Einbeziehung weiterer Disziplinen (insb. Philosophie, Soziologie, Informatik, Zeitgeschichte) geboten.
In einem ersten, in den nächsten ca. zwei bis drei Jahren erfolgenden Schritt sollten Doktoranden aus den beteiligten drei Fächern nicht nur mit der Bearbeitung einzelner Forschungsfragen beginnen, sondern in enger Kooperation mit den Unterzeichnern das Thema interdisziplinär in seinen zahlreichen Dimensionen erschließen. Ergänzend sollten Tagungen durchgeführt werden, die auch bereits andere Fachrichtungen sowie externe Wissenschaftler einbeziehen.